Der Geist in der Materie – oder immer Ärger mit dem Lemma –
Table of Contents
„Geist <–> Materie“ – das Dilemma
Wer weiß, ob die Geschichte anders verlaufen wäre, wäre dem 23-jährigen, jungen Mann, in der Winternacht 1619, im dreißigjährigen Krieg, unweit von Ulm, nicht einfach der warme Kachelofen in der Bauernstube ausgegangen. Dann hätte er vielleicht nicht (aus Langeweile) meditiert und es wäre nicht zu diesem Jahrhundertwerk „Meditationes de prima philosophia, in qua Dei existentia et animae immortalitas demonstratur“ (lat. „Meditationen über die Erste Philosophie, in welcher die Existenz Gottes und die Unsterblichkeit der Seele bewiesen wird“) von 1641 gekommen. Als Basis seiner Philosophie stellt er ein erkenntnistheoretisches Postulat auf, mit dem er quasi als Slogan – oder neusprachlich Meme – gleichgesetzt werden kann mit: „Cogito ergo sum“ (Ich denke, also bin ich.), welches dann auch letztendlich zur Begründung seiner Metaphysik dient.
Renè Descartes
Wer weiß, vielleicht wäre uns vieles erspart geblieben. Aber eines ist sicher, ab da an, war nun der „Leib-Seele-Dualismus“ bestehend aus den „res cogitans“ (den gedachten/zweifelnden Dingen = Geist) und den „res extensa“ (den ausgedehnten/körperlichen Dingen = Materie) unwiederbringlich in die Welt gesetzt. Die Rede ist natürlich von René Descartes (latinisiert Renatus Cartesius; * 31. März 1596 in La Haye en Touraine; † 11. Februar 1650 in Stockholm), der ein französischer Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler war.
Die wissenschaftliche Methodik
Descartes Hauptwerk „Meditationes de prima philosophia“ von 1641 hatte eine bahnbrechende Wirkung auf den philosophischen, aber auch naturwissenschaftlichen Diskurs seiner Zeit und darüber hinaus (vielleicht sogar bis heute).
„Von dem Historiker und Philosophen Wilhelm Kamlah wurde Descartes als erster herausragender Repräsentant der in der oberitalienischen Werkstättentradition der Renaissance entwickelten „Neuen Wissenschaft“(-sauffassung) mit ihrer spezifischen methodisch durchgeklärten Verbindung von mathematischer Theorie und technischer Empirie gewürdigt, die zur Grundlage des modernen Szientismus wurde. Deswegen werde er als „erster philosophischer Dogmatiker der Mechanik […] sachlich und historisch umfassender“ verstanden denn als „Philosoph des cogito sum, der Entdeckung des Selbst aus dem Zweifel“(https://de.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes)
Descartes Philosophie ist von dem Impetus getrieben, die altscholastische Schule aufzuräumen und alles, was nicht beweisbar ist einfach raus zu schmeißen.
„Die in Discours de la méthode von Descartes ausführlich formulierte philosophische Methode wird in vier Regeln (II. 7–10) zusammengefasst:
– Skepsis: Nichts für wahr halten, was nicht so klar und deutlich erkannt ist, dass es nicht in Zweifel gezogen werden kann.
– Analyse: Schwierige Probleme in Teilschritten erledigen.
– Konstruktion: Vom Einfachen zum Schwierigen fortschreiten (induktives Vorgehen: vom Konkreten zum Abstrakten)
– Rekursion: Stets prüfen, ob bei der Untersuchung Vollständigkeit erreicht ist.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes)
Der Skeptizismus
Dieses methodische Vorgehen in der Philosophie darf man durchaus mit der naturwissenschaftlichen Methodik vergleichen. So geht auch die erste Meditation „Woran man zweifeln kann“ auf den Wahrheitsgehalt der sinnlichen Wahrnehmung ein, da sie nicht frei von Täuschungen sein kann (Descartscher Dämon). Hieraus leitet sich ein Skeptizismus ab, der selbst das Wissen über die Wirklichkeit einer Außenwelt in Frage stellt und im Solipsismus mündet. Wenn man natürlich so weit gegangen ist, dass man alles anzweifelt (selbst die eigene Wahrnehmung) ist man selbstverständlich irgendwann gezwungen, wieder Boden unter die Füße zu bekommen und eine Verortung des eigenen Denkens vorzunehmen, um wieder einen Fixpunkt zu erhalten. Und hier kommt Descartes in seiner zweiten Meditation „Über die Natur des menschlichen Geistes; dass er der Erkenntnis näher steht als der Körper“ auf die geniale Idee (die übrigens schon Aurelius Augustinus (354 – 430) hatte) sich selbst als Bezugspunkt zu nehmen.
„Zweifellos bin also auch Ich, wenn er mich täuscht; mag er mich nun täuschen, so viel er kann, so wird er doch nie bewirken können, daß ich nicht sei, so lange ich denke, ich sei etwas. Nachdem ich so alles genug und übergenug erwogen habe, muß ich schließlich festhalten, daß der Satz ‚Ich bin, Ich existiere‘, so oft ich ihn ausspreche oder im Geiste auffasse, notwendig wahr sei.“ (René Descartes: „Philosophische Schriften in einem Band“, 1996, 2. Meditation, Absatz 3, S. 45.)
Der Dualismus „res cogitans“ vs. „res extensa“
Den einzigen Schönheitsfehler, den dieser „Hutzauber-Trick“ hatte, war der, das von nun an der „Leib“ und die „Seele“ oder der „Geist“ und die „Materie“ eine condicio sine qua non bildeten. Wenn ich natürlich alles anzweifele, brauche ich einen sicheren Bezugspunkt meines Denkens, also muss ich zwingend das Denken „res cogitans“ von dem Körper „res extensa“ trennen, damit mich nicht eines der beiden betrügt. Heute würde man vielleicht despektierlich von einer „paranoiden Persönlichkeitsstörung“ bei dieser Menge an Zweifeln sprechen, wenn man nicht wüsste, dass es sich hierbei um eine philosophische Methodik handelt. Aber da der naturwissenschaftliche Diskurs zur Zeit der Rennaissance en vogue war, hatte Descartes Metaphysik eine abstrahlende Wirkung auf die Philosophie, aber auch auf die Naturwissenschaft (Physik, Astronomie, Physiologie) selber.
„Ich kann mir klar und deutlich vorstellen, dass Geist ohne Materie existiert. Was man sich klar und deutlich vorstellen kann, ist zumindest prinzipiell möglich. Also ist es zumindest prinzipiell möglich, dass Geist ohne Materie existiert. Wenn es prinzipiell möglich ist, dass Geist ohne Materie existiert, dann müssen Geist und Materie verschiedene Entitäten sein. Da also Geist und Materie verschiedene Entitäten sein müssen, ist der Dualismus folglich wahr.“(René Descartes: Meditationes de prima philosophia. (1641), S. 98)
Descartes Dilemma
Und zack, schon sind wir bei dem Dilemma, das bei Descartes schon angelegt war. Der Dualismus zwischen zwei scheinbar unvereinbaren Dingen, wie Geist und Materie. Das Dilemma bestand fortan nun darin, dass man fein säuberlich zwischen den Dingen, die den Geist betreffen – also z. B. den rationalistischen Geisteswissenschaften – und den Dingen, die die Materie betreffen – also z. B. den materialistischen Naturwissenschaften – unterscheiden musste, damit bloß keine Vermengung der Entitäten stattfinden und damit unsicherer Boden betreten werden möge. Insofern ist der Vorwurf der Basislegung für den späteren Szientismus durchaus begründet. Descartes Substanzdualismus ist in dem substanzdualistischen Interaktionismus aufgegangen, den zum Beispiel Karl Popper („Drei-Welten-Theorie„) und John Eccles vertreten.
„Geist = Materie“ – das Monolemma
Der vermeintliche Auslöser des ganzen Monolemmas (Neologismus: eine Wahl, bei der man eigentlich keine Wahl hat) war interessanterweise wieder eine banale Begebenheit, ein Sommerspaziergang eines 17-jährigen, jungen Mannes in der Umgebung von Wien:
„An einem heiteren Sommertage im Freien erschien mir einmal die Welt samt meinem Ich als eine zusammenhängende Masse von Empfindungen, nur im Ich stärker zusammenhängend. Obgleich die eigentliche Reflexion sich erst später hinzugesellte, so ist doch dieser Moment für meine ganze Anschauung bestimmend geworden.“ (Ernst Mach:“Beiträge zur Analyse der Empfindungen“ (1886), S. 23)
Wir hätten zwar gerne gewusst, was dieser junge Mann da „geraucht“ hatte, denn aus dieser emotionalen Schwärmerei entstanden ernste Konsequenzen. Sein späteres Werk „Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum Psychischen„ (1886) hatte leider auch Auswirkungen auf die neu gegründete Sinnesphysiologie und wissenschaftliche Erkenntnistheorie.
Ernst Mach
Dieser junge Mann war Ernst Waldfried Josef Wenzel Mach (* 18. Februar 1838 in Chirlitz bei Brünn, Kaisertum Österreich; † 19. Februar 1916 in Vaterstetten, Königreich Bayern). Mach vertrat die erkenntnistheoretische Position, dass sich alle mentalen Zuständen des Gehirns, aber auch die Objekte der Außenwelt letztlich auf rein empirische Entitäten zurückführen lassen. Er war ein österreichischer Physiker, Sinnesphysiologe, Philosoph und Wissenschaftstheoretiker, sowie ein Pionier der gerade entstehenden Wissenschaftsgeschichte. Mach wird als Mitbegründer und Vertreter des Wiener Positivismus und logischen Empirismus bezeichnet, was an den folgenden Kernaussagen zur Erkenntnistheorie abzulesen ist:
„Die Quelle aller menschlichen Erkenntnis ist das „Gegebene“.
1. Gegeben ist nur eine Mannigfaltigkeit von Sinneseindrücken (Empfindungen).
2. Nicht gegeben ist alles, was zusätzlich zu den Inhalten der sinnlichen Wahrnehmung die „Welt“ konstituiert.
3. Die Unterscheidung zwischen Ich und Welt ist haltlos.
4. Es gibt keine metaphysische Erkenntnis über außersinnliche Realität.
In der Wissenschaftstheorie verstand er die Wissenschaften als Mittel, die Welt und die Empfindungen der Menschen möglichst einfach und neutral zu beschreiben. Außerdem verlangte er als Leitkultur der Wissenschaft einen Reduktionismus ohne Kompromisse. Aus diesem Grunde sah er als eigentliche Grundlage eines aufgeklärten Weltverständnisses die Physik und die Psychologie an. Physikalische Theorien seien, ähnlich wie psychologische, nur mathematisch organisierte Naturbeschreibungen. Diskussionen über den Wahrheitsgehalt von Theorien seien daher überflüssig. Allein der Nutzen sei relevant. Wahrheit existiere nicht für sich, sondern als eine temporäre Diskussions-Wahrheit, die nach evolutionären Gesetzen zustande kommt: Nur die stärksten, also ökonomischsten und empirisch klarsten, Ideen setzen sich durch.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Mach)
Machs Monolemma
Starker Tobak, der letztendlich in dieser reduktiven Form bedeutet, dass alles auf die Sinneseindrücke (Empfindungen) zurückzuführen sei. Für Mach herrscht nur dieses eine Monolemma, wonach es nichts Metaphysisches/Immaterielles – also auch keinen Geist – gibt. Für ihn gibt es allein die „Einheit von Ich und Welt“ (Sein und Bewusstsein). Alle sinnesphysiologischen Vorgänge wie Wahrnehmung, Denken und Reflexion lassen sich auf empirische Funktionen, wie Sinneswahrnehmungen, Messwerte, Erlebnisse, Anschauungen, Befunde zurückführen. Dieser neutrale Monismus erscheint sehr dogmatisch und wird auch als eine Radikalisierung des Empirismus in Form des Empiriokritizismus angesehen. Mach ist einer der Mitbegründer oder einflussreichste Vertreter des sogenannten „subjektivistischen Positivismus“ und hatte insofern auch Auswirkungen auf den späteren reduktiven Materialismus/Physikalismus (Carnap/Neurath). Hieraus ist die Identitätstheorie (Place/Smart) in der Philosophie des Geistes hervorgegangen, die den Geist noch stärker auf das rein Materielle reduziert hat.
„Geist/Materie/Vernunft“ – das Trilemma
Dies führt zu einem erkenntnistheoretischen Problem ganz anderer Art, welches aber mit dem vorgenannten Dualismus und Monismus eng verbunden ist. Es geht um die „Subjektivierung von Erkenntnis„, oder wie man moderner sagen würde, um die Rolle des „Beobachters„, den „empirischen Reviewer“. Leider ist zu dieser Erkenntnis keine direkt belegte Anekdote überliefert, aber unsere „idealistische Lichtgestalt“ spricht von einem „großen Licht„, das ihm im Jahre 69 erschienen sei:“Das Jahr 69 gab mir großes Licht.“ (Schlusssatz Reflexion 5037) Wir wissen leider nicht, wie er zu dieser Erleuchtung gekommen ist, aber der vorletzte Satz der Reflexion 5037 gibt einen ersten Hinweis:
„Ich versuchte es gantz ernstlich, Satze zu beweisen und ihr Gegentheil, nicht um eine Zweifellehre zu errichten, sondern weil ich eine illusion des Verstandes vermuthete, zu entdecken, worin sie stäke.“ (Akademie-Ausgabe (AA) XVIII. Ich zitiere im Folgenden Kants handschriftliche Reflexionen zur Metaphysik aus AA Band XVII und XVIII nur nach den Nummern. Bd. XVII enthält die Nummern 3489 – 4846, Bd. XVIII 4847 – 6455.)
Immanuel Kant
Spätestens bei der erwähnten Methode der kritischen Dialektik müsste klar geworden sein, dass es sich bei dieser „Lichtgestalt“ um niemand Geringeren als um Immanuel Kant (* 22. April 1724 in Königsberg, Preußen; † 12. Februar 1804 ebenda) handeln mag. Dabei ist die von ihm verwendete „Lichtmetaphorik“ auch nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern entspricht dem aufklärerischen Diskurs der damaligen Epoche:„»Licht der Vernunft« Nach dem Vorbild der Mathematik als zielgerichtetes Denkvermögen begreift sich die Aufklärung als ein rationales Erhellen jedes denkbaren Sachverhaltes. (Günter Barudio: „Aufklärung“ https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-476-03526-4_7, S.1)
Kants Kritizismus
Und genau an diesem ehrgeizigen Ziel arbeitete Kant. Dabei ist sein philosophischer Werdegang durchaus nicht monolithisch, frei von Brüchen und Widersprüchen. Im Gegenteil gerade diese Kehrtwendung, die man als „vorkritische“ Phase (bis Erscheinungsjahr 1781 der 1. Auflage der „Kritik der reinen Vernunft“ (KrV) gegenüber der „kritischen“ Phase (besonders ab der 2. Auflage der KrV 1787) ist für das Verständnis des später aufzuzeigenden erkenntnistheoretischen Trilemmas ausgesprochen wichtig.«Inauguraldissertation»: Über Form und Prinzipien der Sinnes- und Verstandeswelt (1770); „Kritik der reinen Vernunft“ (1781), „«Prolegomena»zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können“ (1783) liegt in dem Versuch eine neue Metaphysik zu konstituieren, die den Erkenntnisraum des menschlichen Verstandes (der Naturwissenschaft) in seinen Grenzen auslotet:„Was kann ich wissen?„
Humes Auslöser
Auslöser für das ganze Trilemma war eigentlich – um in der Lichtmetaphorik zu bleiben, ein Erwachen aus einem Traum durch einen Lichtstrahl – die Auseinandersetzung Kants mit Humes Kausalanalyse von Ursache und Wirkung 1771, wie er selber schreibt:
„Ich gestehe frei: die Erinnerung des David Hume war eben dasjenige, was mir vor vielen Jahren zuerst den dogmatischen Schlummer unterbrach und meinen Untersuchungen im Felde der speculativen Philosophie eine ganz andre Richtung gab. Ich war weit entfernt, ihm in Ansehung seiner Folgerungen Gehör zu geben,[….] als der scharfsinnige Mann kam, dem man den ersten Funken dieses Lichts zu verdanken hatte.“Kant: AA IV, „Prolegomena zu einer jeden … „, S.
David Humes (1711-1776) entwickelte Erkenntnistheorie aus seinem Hauptwerk „Abhandlung über die menschliche Natur“ kann als Vorläufer des zuvor beschriebenen reduktiven Materialismus bei Mach gesehen werden. Hume versuchte – ganz im Geiste seiner Zeit – mit Hilfe des naturwissenschaftlichen Diskurses die Philosophie von der – aus seiner Sicht – spekulativen Metaphysik zu befreien:
„Ich behaupte, es gibt einerseits keine Frage von Belang, deren Antwort nicht in der WISSENSCHAFT ÜBER DEN MENSCHEN enthalten sein dürfte. Andererseits dürfte keine Frage zutreffend beantwortet werden können, bevor diese WISSENSCHAFT nicht bekannt ist. Wenn ich also vorhabe, die Grundlagen der menschlichen Natur offen zu legen, habe ich vor, ein komplettes wissenschaftliches Gebäude zu entwerfen, das auf einer fast völlig neuen Basis steht. Die einzige, wie ich annehme, von der aus einigermaßen gesichert geforscht werden kann.“(David Hume: „Treatise„, Introduction, 6.)
Die „empirische Psychologie“
Dies glich natürlich einer „Abrissbirne in dem abendländischen Philosophiegebäude“, da es die „Krypta“ – die Metaphysik – betraf. Hume wollte in seinem induktiven Reduktionismus zu gesicherten Erkenntnissen kommen, die allein auf der Basis von Beobachtungen – im Sinne einer „empirischen Psychologie“ – gewonnen werden sollten. Hierbei sollte ausdrücklich auf logische Denkoperationen, wie z. B. bei der Deduktion ausgeschlossen werden. Deshalb wird dieser Ansatz auch Sensualismus genannt. Das durch ihn ausgelöste Grundproblem der Erkenntnistheorie ist als als „Induktionsproblem“ in die Philosophie des Geistes eingegangen. Aber nicht erst seit der Systemtheorie ist bekannt, dass der Beobachter selbst eine erkenntnistheoretische Größe darstellt. Denn bereits Kant verwies in seinem Hauptwerk der „Kritik der reinen Vernunft“ auf dieses Paralogismus-Problem, welches in seiner Ausgangsform an den zuvor beschriebenen cartesischen Dualismus erinnert:
„Der Dualismus von Materie und Geist (Seele, denkendes Wesen) gilt nur „im empirischen Verstande“, d. h.: „in dem Zusammenhange der Erfahrung ist wirklich Materie, als Substanz in der Erscheinung, dem äußeren Sinne, so wie das denkende Ich, gleichfalls als Substanz in der Erscheinung, vor dem inneren Sinne gegeben, und nach den Regeln, welche diese Kategorie in den Zusammenhang unserer äußeren sowohl als inneren Wahrnehmungen zu einer Erfahrung hineinbringt, müssen auch beiderseits Erscheinungen unter sich verknüpft werden“.[…] Materie und Seele sind keine Dinge an sich, sondern nur „die Erscheinung eines Dinges überhaupt“(KrV (I 750 f. – Rc 465 ff. auf https://www.textlog.de/32934.html)
Die „transzendentale Psychologie“
Ein sehr moderner Ansatz, da er doch den „Beobachter“ als experimentierendes Subjekt in den Erkenntnisprozess mit einschließt. Aber Kant beschreitet hier einen „dritten Weg„. Anstelle des materialistisch-empirischen Monismus Humes und des idealistisch-rationalistischen Substanzdualismus Descartes möchte Kant zu einem transzendental-apriorischen Eigenschaftsdualismus und somit zu einer „transzendentalen Psychologie“ gelangen. Dieser rationalistische Ansatz, der auf Christian Wolff zurückgeht, wurde später als „Psychologismusvorwurf“ von Wundt (1910) und Husserl (1910/1911) aufgegriffen. In wie weit sich die Psychologie als Geistes- oder Naturwissenschaft versteht, ist aber ein anderes Thema in einem späteren Essay zur „Neurophilosophie“.
Die Verbindung von Empirismus und Rationalismus
Hier ist vielmehr die erkenntnistheoretische Konstruktion Kants durch die Einführung des Subjektbegriffes in das dialektische Antinomien-Problem (ausgelöst durch Newtons „Principia“) – aus meiner Sicht – von aufschlussreicher Wirkung auf den späteren Diskurs. Kant legt eine transzendentale Klammer um das Materie-Geist-Problem, die den Dualismus zwischen den Empirismus und Rationalismus zusammenführen soll. Kants Transzendentalphilosophie stellt den Versuch dar mit Hilfe einer neuen Metaphysik den Materialismus Newtons mit dem Rationalismus Leibniz zu vereinen.
Das dieses Unterfangen zu groß für ihn werden droht, hat er schon in seiner Monadologia physica (1756) vorausgeahnt:„Doch auf welche Art und Weise läßt sich denn bei diesem Geschäft die Metaphysik mit der Geometrie zusammenbringen, da man Greife leichter mit Pferden als die Transzendentalphilosophie mit der Geometrie verbinden zu können scheint?“ (ebd. W: 519 aus https://brill.com/view/book/edcoll/9783957437761/BP000005.xml?language=de, S. 35)
Das Bieri-Trilemma
Diese transzendentale Verklammerung von Materie und Geist ist leider nicht umsonst, sondern wird durch ein Trilemma erkauft, das auch als Bieri-Trilemma bekannt ist. Dieses Trilemma entsteht durch das Problem der mentalen Verursachung:
- Mentale Phänomene sind nichtphysikalische Phänomene.
- Mentale Phänomene sind im Bereich physikalischer Phänomene kausal wirksam.
- Der Bereich physikalischer Phänomene ist kausal geschlossen.
„Jede der drei Annahmen wirkt auf den ersten Blick plausibel:
– Das Bewusstsein scheint durch seine interne Struktur – insbesondere durch das subjektive Erleben – von jedem physischen Ereignis verschieden.
– Mentale Phänomene (etwa Angst) scheinen ganz offensichtlich Ursache von physischen Phänomenen (etwa Weglaufen) zu sein.
– In der physischen Welt scheinen jedoch immer hinreichende, physische Ursachen auffindbar zu sein.
Das Trilemma besteht nach Bieri darin, dass die Sätze paarweise, aber nicht alle zugleich wahr sein können.“ (Peter Bieri: „Analytische Philosophie des Geistes“ (2007), S.18 auf https://de.wikipedia.org/wiki/Bieri-Trilemma).
Auf eine mögliche Lösung dieses Trilemmas möchte ich aber in meinem späteren Essay „Die Neurophilosophie“ noch genauer eingehen.
Die Neue Metaphysik – der Geist in der Materie
Nichtsdestotrotz stößt Kant hier ein Tor auf, das vorschnell wieder zu verschließen, neue Möglichkeiten hinsichtlich einer „neuen Metaphysik“ – mit heutiger Sicht und Kenntnisstand – ungenutzt verstreichen lassen würde. Doch um zu einer neuen Form von Metaphysik zu gelangen müssen die „alten Gräben“ zunächst einmal zugeschüttet werden, die der Dualismus in Geistes- und Naturwissenschaften hinterlassen hat. Diese epistemologischen Risse und ontologischen Brüche treten besonders in dem wissenschaftshistorischen Verlauf der „Philosophie des Geistes“ zutage, womit sich mein nächster Essay „Die Philosophie des Geistes – der UEPhA-Cup der Ismen“ spielerisch beschäftigen wird.
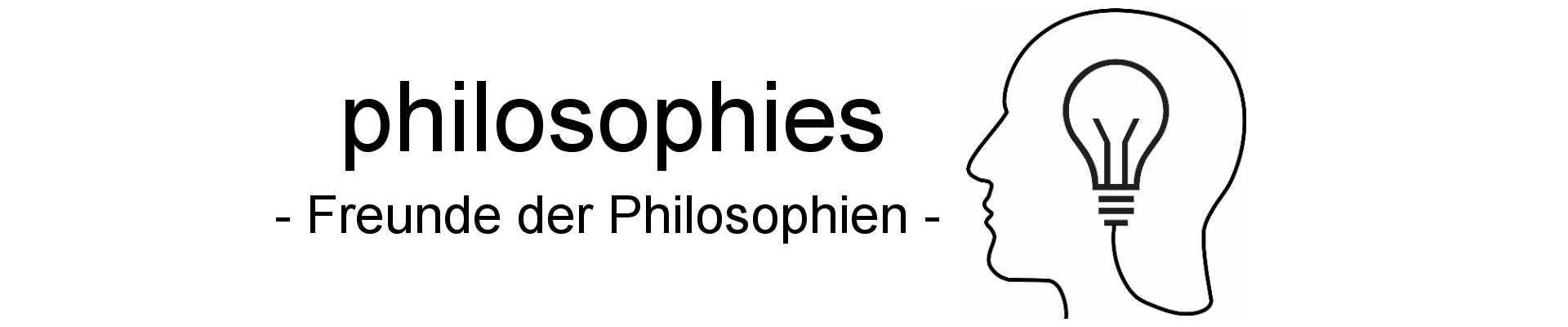
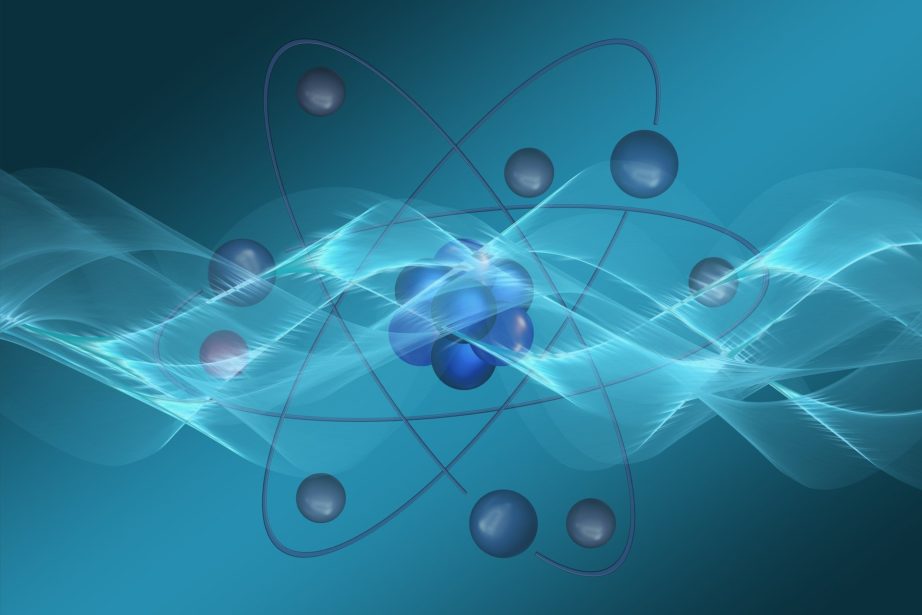


 https://orcid.org/0009-0008-6932-2717
https://orcid.org/0009-0008-6932-2717
Hallo Dirk,
das letzte große Zitat von Kant im Bezug auf Descartes bezüglich der Trennung zwischen Leib und Seele in dem hier vorgestellten Artikel ist der berühmte Fehlschluss von der Epistemologie auf die Ontologie.
Dieser Fehlschluss besteht meiner Ansicht nach auch heute noch in großen Teilen der Neurowissenschaften als auch in der Philosophie. Nun bin ich natürlich nicht im Besitz ontologischer Wahrheiten, sondern besitze auch nur meine eigenen ontologischen Annahmen. Dennoch hat es mich gefreut zu lesen, dass du diesen Fehlschluss hier herausgestellt hast. Denn er ist so alt wie aktuell gleichzeitig und das macht ihn interessant.
Auch das berühmte Trilemma von Bieri, das ja wohl als klassiker in der deutschsprachigen Philosophie des Geistes genannt werden kann, halte ich u.a. deshalb für ein “Scheintrilemma”. Es verbleibt im Rahmen des Leib-Seele-Problems. Die echten Probleme werden somit gar nicht berührt, da man sich in rein konzeptell philosophische Welten verheddert hat die mit der natürlichen Welt diesbezüglich nichts mehr gemein haben. Aber diese Meinung von mir ist natürlich höchst kontrovers. Manch Philosoph würde mir hier wohl nicht nur nicht zustimmen, sondern gar nicht verstehen. Man müsste weiter ausholen um die eigenen Positionen darzulegen.
Wie auch immer: weiter möchte ich dir sagen dass dein Artikel wieder wunderbar kompakt und interessant geschrieben war. Ich bin sehr gespannt auf deinen nächsten Beitrag zur Neurophilosophie.
Hallo Philipp,
das ist schön von Dir zu hören. Ich hatte häufiger nochmal an Dich gedacht – auch im Zusammenhang mit der Arbeit an meinem Essay – (wie Du siehst bin ich der „Neurophilosophie“ treu geblieben 😉
Ich bin Dir auch sehr dankbar für Deinen sehr konstruktiven Kommentar und Dein sehr freundliches Kompliment.
Der Sache mit der Ontologie und der Epistemologie wollte ich ja noch in meinen nächsten Essay genauer ergründen. Die Idee war auch genau mit diesem Bieri-Trilemma einzusteigen, um erst einmal die ganzen „Ismen“ und ihre „materialistischen vs. rationalistischen Lager“ in der „Philosophie des Geistes“ abzuarbeiten. Wäre schön, wenn Du mir bei möglichen Fragen zu der „Neurophilosophie“ nochmal behilflich sein könntest, da Du mehr in der „Materie“ drin bist.
Liebe Grüße
Dirk
Lieber Dirk,
vielen Dank für deinen Kommentar. Mit der Lektüre bin ich – wegen Links – noch nicht ganz durch.
Eine schnelle Anmerkung zur Terminologie : du schreibst, es gehe dir weder um einen transzendentalen noch um einen immanenten Gott. Der Gegenbegriff zu immanent müßte transzendent lauten. »Transzendental« verstehe ich im Sinne Kants als »Bedingung der Möglichkeit von«. Der Gegenbegriff dazu ist vielleicht a posteriori, schwer zu sagen. Begriffe, transzendentale und andere sind für die KrV allesamt immanent. Sie verhalten sich zueinander wie Hausflur und Wohnzimmer.
* * * * * * *
Um mit der Tür ins Haus zu fallen : Was allen Menschen gemeinsam ist, den Dümmsten wie den Klügsten, ist die Fähigkeit zur Dialektik. Philosophie und Common Sense gehen davon aus, daß Tiere, wenn sie überhaupt denken, das nur in Form von dyadischen, zweikategorialen Systemen erledigen können; daß ihnen die Fähigkeit zur Vermittlung der Kategorien durcheinander abgeht.
Weil uns nur das von ihnen unterscheidet, sollten Common Sense und [europäische] Philosophie richtig liegen. Liegt diese falsch, ist sie eine Kannibalendoktrin; liegen wir falsch, sind wir Menschenfresser. Die menschliche Fähigkeit zur Dialektik stellt Kant in der Kritik der Reinen Vernunft unendlich oft dar; oft unendlich kompliziert, oft abschreckend auch für einen Leser, der schon weiß, daß er in einer bis heute unangefochten gültigen Unabhängigkeitserklärung der Filosofie blättert; manchmal aber auch anschaulich, nämlich als eine Eigenart der Menschensprache :
»… daß allerwärts eine gleiche Zahl der Kategorien jeder Klasse, nämlich drei sind, welches eben sowohl zum Nachdenken auffodert, da sonst alle Einteilung a priori durch Begriffe Dichotomie sein muß. … Dazu kommt aber noch, daß die dritte Kategorie allenthalben aus der Verbindung der zweiten mit der ersten ihrer Klasse entspringt.« [KrV, Kapitel »Von den reinen Verstandesbegriffen«]
»Die dritte Kategorie entspringt allenthalben aus der Verbindung der zweiten mit der ersten ihrer Klasse« : diese Fähigkeit zur Vermittlung der Kategorien durcheinander, eben die Fähigkeit zur Dialektik ist die Voraussetzung für den spezifisch menschlichen Trick, das Hirn zur Reflexion zu trainieren. Man könnte sagen, die Kritik der Reinen Vernunft ist nichts als eine analytische Entfaltung dieses Satzes.
Einheit, Vielheit und Allheit sind die ersten drei Kantischen Kategorien. Wendet man die Regel, nach der die dritte die beiden ersten konfiguriert, auf sie an, ergibt sich Folgendes :
Die Allheit (Totalität) ist nichts anderes als die Vielheit als Einheit betrachtet.
Im Begriff »Alles« präsentiert sich der Begriff »Vieles« als Begriff »Eins«.
Die Allheit [Nr 3] ist die Vorstellung der Vielheit [Nr 2] als Einheit [Nr 1].
Alles ist Ein Vieles. A = E/V.
»Realität«, »Negation« und »Limitation« bilden die nächste Trias der Kategorientafel. Wendet man die Konfigurationsregel auf sie an, erhält man den schönen, mehrfach umformbaren Satz
»Die Limitation ist die Negation im Realen«
oder
»Durch Negation schafft das Reale seine Binnengrenzen«.
Du kannst deshalb Figuren erkennen, weil jede einzelne sich durch eine Kontur realisiert, deren Inneres das äußere Drumherum negiert – wie umgekehrt das Drumherum durch sein Enden an der Kontur die Figur limitiert : ein Bild, jedes Bild gibt dir
Anschauungsunterricht in transzendentaler Kategorienlehre.
Was das Bild darstellt, weißt du durch Bildung; daß es überhaupt etwas darstellt, weißt du, weil die Kategorien Realität, Negation und Limitation dir die Fähigkeit geben, Flächen und Linien zu Figuren, Figuren zu Gruppen, Gruppen zu genau dem räumlichen Neben- und Hintereinander zu verbinden, das der Maler suggeriert.
Banal ? – Ja sicher.
»Aber verlangt ihr denn, daß ein Erkenntnis, welches alle Menschen angeht, den gemeinen Verstand übersteigen, und euch nur von Philosophen entdeckt werden solle? Eben das, was ihr tadelt, ist die beste Bestätigung von der Richtigkeit der bisherigen Behauptungen, da es das, was man anfangs nicht vorhersehen konnte, entdeckt, nämlich, daß die Natur, in dem, was Menschen ohne Unterschied angelegen ist, keiner parteiischen Austeilung ihrer Gaben zu beschuldigen sei, und die höchste Philosophie in Ansehung der wesentlichen Zwecke der menschlichen Natur es nicht weiter bringen könne, als die Leitung, welche sie auch dem gemeinsten Verstande hat angedeihen lassen.«
Schreibt Kant aaO, also ganzganz hinten im Buch. Sehr lange habe ich das schlicht und einfach überlesen.
Hatte wohl auch sein Gutes :
»Kants Witz. – Kant wollte auf eine alle Welt vor den Kopf stoßende Art beweisen, daß alle Welt recht habe – das war der heimliche Witz dieser Seele. Er schrieb gegen die Gelehrten zugunsten des Volks-Vorurteils, aber für Gelehrte und nicht für das Volk.« [Nietzsche, Die Fröhliche Wissenschaft]
Philosophie muß banal sein. Was sie sagt, soll auf jedem Symposium gesagt werden können; es soll für jeden gelten, von Pfeife bis Flöte. Was sie gemeinsam haben, kann in der Darstellung vielleicht, in der Sache aber bestimmt nicht kompliziert sein. Deshalb hat der Common Sense jeden berühmten Filosofen unter einem einzigen Kernsatz gespeichert, »Alles fließt«, »Das Ganze ist das Vernünftige«, »Religion ist Opium …«, »Worüber man nicht reden kann …«, »Geliebt wirst du einzig, wo …« &c.
Der Gegenstand der Philosophie ist in der Tat winzig, fast Nichts. Stimmt. Was ein Mensch über Welt und Ich wissen kann, ist das, was Sinne, Hirn und Sprache ihm wie jedem anderen zu sagen erlauben.
Dabei geht es weniger um das endliche Finden einer »Wahrheit« als um die Sukzession im Zweifel, im Be-Zweifeln jedes Gedankens, den ein Denkender faßt. Letztlich liegt hier, so banal es wiederum klingt, der Hund begraben, der unter den dreist errichteten Bauten des wissenschaftlichen Sozialismus vor sich hin fault.
Seit mindestens 2500 Jahren hinterlassen dazu – : zu dem Zweck, zu sagen, was das ist, was für Jeden gilt – Meisterdenker ihren Schülern und anderen Nachfahren ausformulierte Denk-Gebäude, die weitergedacht werden sollen. Die Unabschließbarkeit dieser »Arbeit« versteht sich fast von selbst, braucht man einem Philosophen bestimmt nicht zu erklären.
Eine neue Filosofie schließt sich an, arbeitet sich ein, zitiert, kompiliert, kommentiert, interpretiert Traktate Alter und Neuer Meister, die auf demselben Weg zustandegekommen sind.
Die Filosofie hat nicht nur kein Ende; sie hat nicht mal einen Anfang.
Schön, daß man auch gar nicht bei Null anfangen muß. Schöner noch, daß man es auch dann nicht könnte, wenn man wollte; am schönsten aber, daß es eine ausführlich kommentierte Liste der Letzten Dinge : daß es die Kritik der Reinen Vernunft schon gibt. Kein Philosoph nach Kant hat es gewagt, dieses Buch zu verwerfen. Hegels weiterführende kritische Interpretation der KrV ist Ansichtssache; Schopenhauers Hegelkritik erst recht; Nietzsches Schopenhauerkritik darf man ungestraft albern finden; deftige Nietzschekritik ist bereits notwendiger Teil der Nietzschelektüre.
Bei Kant ist alles anders. Dabei trägt sein Jahrtausendwerk das Wort Kritik bereits im Titel. Was bedeutet Kritik bei Kant ? Kritisiert er die Vernunft ?
Lieber Dirk,
Vielen Dank für eine kurzweilige Bustour quer durch HH.
Hier kommt eine schnelle Antwort, natürlich vom Schreibtisch. Diese Hamburger Rallyefahrer des ÖPNV lassen einen ja nicht in Ruhe tippen.
Du hast ein Talent, mit aufgekrempelten Ärmeln tief ins lichtlose Aquarium, ne warte, besser : tief in die übervolle Truhe der Denkfiguren hineinzugreifen, jeweils zwei herauszuheben und dem Publikum zu präsentieren. An jeder hängt ein närrisch langer Beipackzettel, auf dem Verwandtschaften, Feindschaften, Unverträglichkeiten, Risiken, aber auch denkbare, populäre, unpopuläre, naheliegende und unverhoffte Fertilitäten vermerkt sind.
Dein Essay kingt in der jetzigen Fassung eher wie ein komprimierender Artikel aus einem philosophischen enzyklopädischen Handbuch, eine tour de force durch fünf Jahrhunderte. Für meinen Geschmack ist er noch zu fußnotenlastig. Die meisten Links müßtest du (imao) mit ein paar Sätzen ausführen.
Mein grundsätzlicher Einwand beginnt bei der Einschätzung des Duals aus cogitari und extendere. Ich denke – ich bin – ich existiere sind in meiner Interpretation äquivalent, bis fast zur Identität. Existere ist kein Gegensatz zum „realen“ Dasein; existere ist praktisch gleichbedeutend mit esse.
Daß es existiert, also ist, ist das einzige, was vom Denken sicher gewiß ist. Denken hat aber ebenso sicher keine Ausdehnung. Es ist da, aber extendiert nicht. Einem Ding der sinnlichen Wahrnehmung das Extendieren abzusprechen wäre albern, weil es nur so existieren = sein kann. Existere und extendere drücken nicht zwei entgegengesetzte Prinzipien aus.
Spinoza, ein weiterer junger Mann und Anwärter auf Dein Narrativ von „Was wäre, wenn“ macht das Verhältnis gleich in den ersten beiden Definitionen der „Ethik“ klar.
Was einen Körper hat, ist nicht Denken. Was ein Denken ist, hat keinen Körper. Aber beide gehören deshalb nicht zu verschiedenen Seinsordnungen.
Darum ist es auch nicht angemessen, diesen Dualismus als „Paranoia“ eines Denkers oder einer Tradition zu rekonstruieren. Ohne Frage ist die Beziehung ein Dual, aber nur im Sinne verschiedener Modi. Modus 1 = Denken; Modus 2 = räumlich vorhanden Sein.
Der Gegensatz zwischen Geistes- und Naturwissenschaften ist (immer imao) nicht aus diesem Dual entstanden – der begnadete Mathematiker Descartes hätte sich, wie der begnadete Handwerker Spinoza sicher sehr gewundert über unsere wasserdichte Trennung der „Fächer“ voneinander. Der heutige Unsinn der Scheidung von Geist und Natur hätte sie vielleicht sogar amüsiert.
Ich verdächtige eher die späte, die Schwurbelphase der Universitätsphilosophie, Wilhelm Dilthey ff, als es schon Usus war, von „Weltanschauung“ zu reden, als sei sie ein Vermögen des Verstandes resp des „Gemüts“ (= einer der doitschesten aller doitschen Begriffe).
Die wasserdichte Abtrennung der Philosophie von anderen Verfahren der Rationalisierung menschlicher Verfügung über die Welt klingt für mich nach der kleinlichen Selbstsucht eines Professors, der seinen Claim absteckt.
Grüße aus Panikland (sehe gerade nebenher das heute-journal)
Theo
PS : Ich habe mir zwar noch mehr Notizen gemacht, aber ich schicke dir erst mal das hier. Die Konvertierung von Notizen in Sätze ist schön und lohnend, aber dauert. Wem sage ich das.
Lieber Dirk,
[Lieber Theo,
ich verschicke dann mal wieder „Blaue Briefe“ in eckigen Klammern.]
Danke abermals für Deine „eingequetschte“ schnelle Antwort. Ich freue mich sehr, daß wir die Unterhaltung mehr auf (quasi) Anrufbeantworterebene fortsetzen als auf dem leidigen Level der (quasi) Seminarreplik.
[Gerne. Finde ich, dass dies die „Unterhaltung“ spannender macht. Ansonsten komme ich mir auch immer so vor, als ob ich Monologe mit meiner Schreibtastatur halte.]
Ich verstehe Descartes‘ Meditationen und Spionozas Ethik als zwei Wege durch dasselbe Labyrinth; der eine geht vom Ziel zum Start, der andere umgekehrt. Beide orientieren sich an denselben Zeichen auf dem Weg. Ariadnes berühmter Faden, einmal gelegt, führt in beide Richtungen, Hänsels Kieselsteine aber auch. Ich denke, der gemeinsame Name aller validen Zeichen ist „lumen naturale“, heute bekannt als „Evidenz“. Spinoza macht die Rolle des Menschen klein, Descartes macht sie groß.
[Leider habe ich mich noch nicht genügend mit Spinoza beschäftigt (steht auch noch auf meiner todo-Liste ganz oben), aber ich habe schon mitbekommen, dass der Gute zur Zeit sehr en vogue ist. Aus meiner Sicht vielleicht auch als mögliche Replik zur der momentanen Sinnfrage und der Suche nach Metaphysischem, da er den heutigen sogenannten Atheisten oder Pantheisten mögliche Schnittstellen anbietet (was meinst Du?).
Spinoza betont – nach meinen Recherchen – immer die Natur als eine Substanz quasi als „Gottersatz“ (oder Surrogat – hier denke ich immer an Caro-Kaffee, kennste noch? 😉 und die „Dinge ebenso wie die mentalen Vorgänge der Menschen [seien] nur Modi dieser einen Substanz (https://de.wikipedia.org/wiki/Monismus)“ deshalb wollte ich ihn in „Der Geist in der Materie“ auch unter dem Monismus verbuchen, fand seinen Ansatz aber nicht so spannend – wie ich schon bereits geschrieben hatte – im Vergleich zum Mach, der war mir doch etwas materialistischer im Vergleich zu Spinoza. Er musste zwar auch schon mal als „Vater“ der modernen Naturwissenschaften herhalten in einem Essay von Eric Schliesser: „Spinoza and the Philosophy of Science: Mathematics, Motion, and Being“
(https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195335828.001.0001/oxfordhb-9780195335828-e-020). Mag etwas dran sein, fand ich aber nicht so eklatant. Aber das mit Descartes – und seiner Größe – sehe ich auch so, der macht sich ganz schön groß, nur wegen dem bisschen „Denken“ ;-)]
Nach Descartes müßte „die Welt“ an der Rezeption des Philosophischen Instituts eine Greencard beantragen, um „existieren“ zu dürfen. Ausgerechnet dort. Da lacht schon jeder LK Physik. – Spinoza müßte sich dagegen fragen lassen, wie denn überhaupt trotz der allgegenwärtigen beschränkenden Determiniertheit jemals ein kleiner Mensch dahinterkommen konnte, wie das Große Ganze tickt. – Beide haben allerdings kräftig an der Relativierung der narzißtischen Philosophie mitgearbeitet, der eine als Schöpfer des nach ihm benannten Koordinatensstems, der andere als Pusher der Mikroskopisierung. – Ich, der spätest Nachgeborene versuche es eher mit dem Zeichenstift.
[Hahaha, sehr witzig formuliert und super gezeichnet von Dir. Hast Du das selber gezeichnet? Respekt!
Die beiden Tierfiguren haben mich irgendwie an Kants Vergleich mit den „Pferden und den Greifen“ erinnert: „die Metaphysik mit der Geometrie zusammenbringen, da man Greife leichter mit Pferden als die Transzendentalphilosophie mit der Geometrie verbinden [kann]“. So kommt es mir manchmal auch vor mit der ganzen Interdisziplinarität, ohne die es meines Erachtens aber nicht geht. Ansonsten sitzen die einen weiterhin vor ihren „Mikroskopen“ und finden Dinge (Phenomena) in der Welt, die sie eigentlich schon vorher gesehen haben, nur nicht erkannten. Und die anderen sitzen weiterhin vor ihren „Logoskopen“
[Mist, gibt es leider schon. Ich dachte, ich hätte einen Blick durch das Logoskop getan und einen Neologismus erfunden s. https://www.heise.de/download/product/logoskop-68662, http://bible2.net/de/package/logoskop-wort-betrachter-offline%5D
und finden Sätze (Noumena) in der Welt, die sie eigentlich schon vorher wussten, nur noch nicht erkannten. Aber so ist das mit der Erkenntnistheorie, wobei ich mich hier schon oft gefragt habe, warum sie nur mit der Episteme aber nichts mit der Techne zu tun haben soll. Daher fand ich auch den Ansatz, den die neu entstandene Disziplin „Neurophilosophie“ (ob man die so nennen muss, steht auf einem ganz anderen Blatt) betreibt, sehr vielversprechend. Ich hatte mich mal mit einem Denkerecke-Mitglied zu diesem Thema ausgetauscht, der zu diesem Bereich forscht.
Aber wenn ich in der Bildinterpretation bleiben darf, für mich ist das Forschungsgebiet der Neurophilosophie u. U. der „grüne Schlauch“ zwischen den „non-human“-Wesen in einer strukturell gekoppelten Form. Ich hoffe, dass ich hierzu wieder etwas „zusammenschwabulieren“ kann. ]
Die Kantischen Kategorien, die bei den trivialen Aussagesätzen („Urteile“) anfangen und sich bis in die verrücktesten Spekulationen („transzendentale Antinomien“) fortsetzen, gelten für die intersubjektive Sphäre und nur dort. Also für Ästhetik, Logik, Kommunikation, Moral uä.
In ihrem Bereich funktionieren sie auf einer Skala von der mechanischen Reprodukton einer Matriuschkapuppe [MK] bis zur transformierenden Metamorphose [TM], mit mal mehr, mal weniger Mythos. Aber immer bleiben sie intersubjektiv plausibel.
[Erinnert mich in der Aussage und Wirkung wieder stark an die anfangs erwähnte Systemtheorie, die ähnlich dekonstruktivistisch (oder besser gesagt konstruktivistisch methodisch vorgeht). Von der Methodik her gehe ich da auch ganz d’accord. Alles in sich logisch, inhärent und kohärent. Passt alles genauso gut, wie die erwähnte Matrjoschkapuppe zusammen (das Bild mit den Schalen ist ganz gut). Ich finde ja – wie schon mal erwähnt – das Kant mit seinem Schweizer Offiziersmesser sehr scharfsinnig schält. Ich finde die Systemtheorie koppelt auch verdammt gut. Aber immer fehlt da noch was. Ich habe es den „missing link“ oder „fehlenden Mittelfinger[sic!]-Knochen der paläontologischen Philosophie“ genannt. Will sagen, warum bleibt das Ganze nur so eine „Luftnummer“, wie Du es vorhin Spinoza und Descartes vorgeworfen hast. Wo ist das Ontische? Oder wie wäre es hier mal mit Heidegger nach der „ontisch-ontologischen Differenz“ zu suchen?]
Ein abstraktes Bild [mein Meister : Malewitsch] teilt immer noch etwas Begreifbares über räumliche Proportionen mit; ein reimloses Gedicht codiert jedenfalls [für den gutwllligen Leser] nachvollziehbare Gedanken; eine asymmetrische, „atonale“ Musik hat mindestens [für den Hörer, dem die klassischen Parameter überschreitbar sind] Anfang, Mitte und Ende. Da beißt keine Maus einen Faden ab.
Innerhalb der intersubjektiven Sphäre gibt es keine Mysterien, weil Worte, Sinn, Gehalt, Figuren, Bedeutungen etc nicht nur die Mittel, sondern gleichzeitig auch die Zwecke sind. Kants wunderbare Entdeckung besteht nicht bloß darin, daß Ästhetik [= Wahrnehmung, bis hin zur Kunst], Logik, Kommunikation, Moral &c grammatikbasiert sind. Das triviale Sprichwort „Sunt pueri, pueri puerilia tractant“ – : „Sie sind halt Kinder, und Kinder treiben Kinderkram“ gilt auch allgemein; setze statt pueri „homines“ und statt puerilia „grammatica“.
Kant zeigt, daß das überall waltende Prinzip der Dialektik diese Trivialität aufhebt. Es enthält einen unbegreiflichen, sprachlich eben nicht eins zu eins darstellbaren Rest. Der einfachste Vierwortsatz ist schon „dialektisch“, nicht erst die groß angelegte Spekulation über den Ursprung der Welt oder den Freien Willen.
Die Spekulation auf die letzten Dinge steigt wie ein Dampf bereits aus den simplen Urteilsformen und hüllt sie ein. Die intersubjektive Welt ist, wie Hegel sagen würde, „an ihr selbst“ dialektisch und daher metaphysisch. Die Dialektik hat immer ein Bein draußen, im nicht Vorstellbaren, aber zwanghaft Mitgedachten und Mitgemeinten.
[Und genau da hege(l) ich meine Zweifel. „Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.“ Diese „Intersubjektivität“ oder „das Ding an sich“ oder die „intersubjektive Welt“ als dialektisches und daher metaphysisches „an ihr selbst“ ist für mich genau der besagte „Hutzauber-Trick“. Inwiefern – und darum geht es Kant ja, so wie ich ihn verstanden habe – kann von allgemeingültigen, intersubjektiven Gesetzmäßigkeiten sprechen, welche den Rand meines und anderer Menschen Erkenntnisraumes und darüber hinaus [sic!] abbilden sollen. Also eine Intersubjektivität, die ich durch Subjektivierung gewonnen habe, wobei ich mich gleichzeitig durch die Dialektik wieder aus der Gleichung herausstreiche. Hmmh, aus Sicht der formalen Logik durchaus machbar, aber nicht validierbar. Das gelingt meines Erachtens eleganter mit der Einbeziehung des „Beobachters“ als Subjekt in der Theoriearchitektur der Systemtheorie, wenn man – wie gesagt – von einer strukturellen Kopplung ausgeht. Dann hat man wenigstens wieder etwas ontologisches (vielleicht sogar ontisches) in Form einer Struktur zu Grunde gelegt. Ist mir persönlich handfester und durch die Kognitions-/KI-/Kybernetikforschung (’ne Menge Ks) besser belegbar.
Aber lustigerweise erinnert mich das gerade an eine Korrespondenz, die ich auch momentan mit einem FB-Mitglied führe, wobei ich aber hier genau andersherum argumentieren muss. Mein Korrespondent argumentiert stark auf der ontischen, mathematisch-physikalischen Basis (allerdings natürlich bezogen auf die Sprache – andere Entitäten, wie Du weiter unten ausführst, machen natürlich in diesem Zusammenhang keinen Sinn). Hier versuche ich mit einer mehr metaphysischen Perspektive – wie Du gerade – zu argumentieren.
Ich habe mal wieder den Verdacht, dass es sowieso wieder mal nur um die verschiedenen Seiten derselben Medaille geht. Und beide Beschreibungen absolut korrekt sind. Wenn ich das noch ergänzen darf, ich denke sowieso Hans Blumenberg hat mit seiner „Beschreibung des Menschen“ vollkommen Recht und Rolf Mengert beschreibt dieses Problem auch sehr präzise in „Hans Blumenbergs interdisziplinär fundierte Anthropologie“(https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/6816/Dissertation_Rolf_Mengert.pdf?sequence=1&isAllowed=y), egal wie wir es wenden und drehen, letztendlich entdecken wir nur uns selbst unter dem o. g. „Mikroskop“ oder „Logoskop“. Vielleicht findet man deshalb den „Anthropozentrismus“ auch bei Kant und seinen Widerhall im starken/schwachen anthropischen Pinzip im Bereich der Naturwissenschaft (hier besonders Astrophysik, s. Hawking).]
* * * * * * * * * *
Die Kantischen Kategorien gelten nicht oder nur sehr vordergründig für Medizin, Astronomie, Chemie, Biologie uä., kurz : für die „Objekt“wissenschaften, die sich der Sprache nur deshalb bedienen, weil nicht jeder Leser die Eleganz einer Formel versteht, die aber eigentlich gemeint ist.
„Meta“physik gehört ganz bestimmt nicht zu den Intentionen der Physiker; von Metabiologie, Metamedizin, Metaastronomie, Metaneurologie hat man schließlich auch nie gehört.
[Wäre aber vielleicht mal eine Einführung wert 😉
Ist aber vielleicht nur eine Standpunktsache, was man unter „Metaphysik“ versteht. Für mich zählt definitiv schon die Epistemologie dazu. Deshalb verschweigen/leugnen beispielsweise Naturwissenschaftler auch immer gerne den erkenntnistheoretischen Weg ihrer Forschungsergebnisse und Entdeckungen (von T. S. Kuhn hinlänglich untersucht und bewiesen); Beispiele hierzu wären die „Schlangen des Kekulé“ oder die „Wendelholztreppe von Watson/Crick“. Wenn Du das lesen würdest, wie hier moderne Forschung auf „höchstem Niveau“ „rein-empirisch und daten-basiert“ betrieben wurde, ist der Begriff „Metaphysik“ noch geschönt ,“Alchemie“ würde besser passen ;-). Ach und apropos, Induktion ist bei den Natwiss ja alles, Deduktion ist bääh und für die Geistwiss, aber dass die „Herren in Weiß“ auch bei ihrer Forschung „Abduktion“ betreiben, ohgottohgott, das darf man gar nicht sagen, was für ein „Sakrileg“. Ich darf das sagen, weil ich selber ursprünglich aus dem Natwiss-Zirkus komme und Kuhn mit seiner Theorie zum „Paradigmenwechsel“ Recht hatte, da gehen eher noch ein paar Kamele [sic!] durchs Nadelöhr, als dass ein Forscher zu einer „objektiven“ Wahrheit gelangt wäre.
„Natürlich gibt es keine Transzendenz der Bedeutung, Sinne sollten wir sagen. Wir sollten von der Suche nach der Bedeutung von Dingen sprechen, indem wir ihnen unterschiedliche Bedeutungen zuschreiben. Es macht keinen Sinn, Transzendenz in den Sinnen zu suchen. Andererseits ist es vollkommen missbräuchlich, ihre Kohärenz zu leugnen, und ist nur das Ergebnis eines Missverständnisses der Logik, die ihren Definitionen in dieser physikalisch-mathematischen Sprache vorstand. Was die Inschrift in einem Modell oder in einem globalen Ziel betrifft, würde ich sagen, dass dieser Standpunkt vollständig eschatologisch ist und nur diejenigen einbezieht, die daran glauben wollen. Alfred North Whitehead nannte diese Art von Information „inert“ oder „inert“, aber dieser metaphorische Begriff lässt die Information zu passiv erscheinen.“ Ist von dem besagten FB-Kollegen und dieser Sache mit Whitehead und der Prozessphilosophie wollte ich noch genauer nachgehen. Scheint mir auf den ersten Blick ein wenig zu ganzheitlich-esoterisch, aber ist ja vielleicht noch einen zweiten Blick wert.]
Grüße
Theo
[Grüße zurück
Dirk]
Lieber Herr S.,
zunächst einmal herzlichen Dank für Ihr großes Interesse an meinen kleinen Versuchen. Ich versuche auch Ihre absolut berechtigten Fragen – so gut es geht – zu beantworten.
Zu Ihrer ersten Frage:“Es bleibt aber immer noch unklar, inwiefern das Physische das Mentale bewirken kann, sofern das Mentale nicht zugleich auch physisch ist ?“ Stimmt, ich habe auch nie behauptet hierzu Lösungen zu besitzen (dann wäre ich vielleicht ein Buchautor oder Sektenführer 😉 Ich bin wahrscheinlich ebenso auf der Suche – wie Sie -, dabei würde mich aber noch brennend interessieren, zu welchen Ergebnissen Sie bisher gekommen sind.
Zu Ihrem nächsten Einwand, zu den Problemen des Herrn Descartes und des Herrn Bieri: da stimme ich Ihnen ebenfalls zu. Das Geist-/Materie-Problem wird von keinem der beiden gelöst. Descartes stellt einen Substanzdualismus auf, Kant läuft auf einen Eigenschaftsdualismus zu (zumindest aber auf einen Perspektivendualismus) und insofern schien mir der gute Bieri gut geeignet, dieses Problem darzustellen, aber nicht zu lösen (s. o.). Ach so, (nur zur Interpretationshilfe) nicht _ich schreibe_, „dass die drei Thesen ( Bieri – Trilemma ) prima facie plausibel scheinen“, sondern _ich zitiere lediglich „Res ipsa loquitur“_ Herrn Bieris-Thesen 😉
Aber was Sie schreiben ist vollkommen korrekt, denn genau da wollte ich ja hin. Aus diesem Grunde heißt mein Versuch ja auch „Der Geist _in_ der Materie“ und nicht „Der Geist versus oder gleich die Materie“. Dieser Versuch sollte lediglich den Nexus zum nächsten Essay „Neurophilosophie“ (https://philosophies.de/index.php/category/erkenntnistheorie/) darstellen, in dem ich versuchen wollte dieses Phänomen näher zu beleuchten (aber bitte auch hier keine Lösungen erwarten 😉
Und der Passus mit dem „Empiriokritizismus“, da gebe ich Ihnen vollkommen Recht, der war in dieser Form missverständlich von mir formuliert. Ich habe ihn nochmals überarbeitet und hoffe, dass er nun präziser ist. Damit es nicht zu derlei möglichen Missdeutungen von Materialismus und Empiriokritizismus kommen mag, die schon bei Lenin zu finden waren (über die möglichen Auswirkungen möchte ich mir gar keine Gedanken machen 😉 Und da haben Sie mich – oder besser gesagt Herrn Mach – missverstanden, er macht gerade keinen Unterschied zwischen „Ich und Welt“: „Für ihn gibt es allein die „Einheit von Ich und Welt“ (Sein und Bewusstsein). Alle sinnesphysiologischen Vorgänge wie Wahrnehmung, Denken und Reflexion lassen sich auf empirische Funktionen, wie Sinneswahrnehmungen, Messwerte, Erlebnisse, Anschauungen, Befunde zurückführen. Dieser neutrale Monismus erscheint sehr dogmatisch und wird auch als eine Radikalisierung des Empirismus in Form des Empiriokritizismus angesehen.“
Es würde mich aber sehr freuen noch einmal etwas von Ihnen (zu hören) zu lesen, da ich schon sehr gespannt auf Ihre Sicht des „Geist-/Materie-Problems“ bin.
Mit philosophies Grüßen
Hallo Dirk,
falls du Fragen hast kannst du diese gerne an meine Emailadresse senden. Eventuell kann ich deine Fragen beantworten bzw. werde das natürlich tun sofern ich über das notwendige Wissen verfüge. Auch weitere Artikel oder Bücher über die Thematik könnte ich empfehlen. Je nachdem was dir vorschwebt.
Das Feld ist so kontrovers dass du bei deinem Artikel grundsätzlich gesehen nicht viel falsch machen kannst, da ohnehin alle Meinungen über Definition und Methodologie bestehen.
Hallo Philipp,
das ist supernett von Dir.
Liebe Grüße
Dirk
Cher M. C.,
merci pour ton commentaire amusant, que j’ai beaucoup apprécié dans ma chambre obscure ;-).
C’est dommage que je n’ai pas rencontré votre goût. Mais au lieu d’écrire une „Critique du jugement esthétique“, j’aurais été plus utile avec une „Critique de la raison pure“ en termes de contenu. Je serais donc très intéressé par les prétendues «erreurs» (surtout avec Kant). Veuillez me laisser participer à vos „ratiocinations“.
Salutations et bonne année
philosophies.de
Dear Mr. D. L.,
phew, you’ve made a great effort with my little essay, I don’t even know where to begin so that the whole thing doesn’t reach the epic length of an essay again. This is just for explanation, so that you know that I really appreciate your very interesting, insightful comment, but I cannot go into everything that you have written to me. And again a big compliment that you published my essay in your group as an admin, although you cannot necessarily agree with it. This shows human generosity and philosophical tolerance.
But (oops, I’ve done it again, always those inappropriate transitions) now to the content. On „First“ (which, by the way, is not followed by a „Second“ ;-). Oh, you don’t like 😉 because it sounds too „young, naive and inexperienced“ (by the way, thanks again for the compliments, if you would know how old I am * g *) I prefer to use * g in the following *, may appear „older, more serious and more experienced“.
Regarding your „first“, here I actually see only an argumentum ad hominem, since it is only about my person. Just to explain, for this very reason I don’t use a real name, because it’s about the thing and not the person. A personality cult that is very common here on FB – „the vanity fair“ – is far from me. But if you are interested, you can also find me on the Internet (● ‚◡‘ ●) (even more „youth style“, please do not be angry).
Let us now come to something more substantial, in the truest sense of the word. If I use „Descartes‘ substance dualism“ in my text, it is of course absolutely clear to me that this is a label that we posthumously put on dear Mr. Descartes and his philosophies. To what extent such isms contribute to a clarification of the content and not rather to ideological localizations, I tried to clarify in another essay to which I would like to draw your attention, also at the risk that it may even less suit your „taste“ ( https://philosophies.de/index.php/2021/01/10/die-philosophie-des-geistes/#The%20philosophy%20of%20mind%20-%20the%20UEPhA%20Cup%20of%20Isms ). Regarding your objection: „Assuming it applies to Descartes that“ he sets up an epistemological postulate as the basis of his philosophy „, it also occurs to me that Descartes did not assert this claim to what he sets up as a basis of his philosophy, and that he would not know what „an epistemological postulate“ is.“
I see it exactly that way, but it was not my declared aim to use the mentioned philosophical concepts in a contextual context. It is usually not possible for the authors of philosophical texts to anticipate the later exposition and interpretations. And to what extent we correctly interpret the actual intentions of the authors is a question of hermeneutics and unfortunately cannot be answered correctly here. As you can see, even my „little treatise“ gives enough leeway for interpretation and leaves me – in my opinion – misunderstood * g *.
But now on to the facts that are not „alternative“ in this case (I just wanted to put a * g * again, but I was able to hold back). Your question about the meaning of a monolemma amazes me because it was explained in the text: „monolemma (neologism: a choice where you actually have no choice)“. And the name is actually owed to the pun, but with the very serious background that you actually had no real „choice“ in this supposed „election“, but that’s the way it is with monism and some party systems.
And now you should let me have the fun of writing, because I see that your „Pop Quiz“ also have a certain kind of humor. It’s good that I’m not a candidate at Jeopardy! and you gave the answers yourself * g *. But your question „How did Kant reconcile the dispute between rationalism and empiricism?“ still occupies me. And your answer: „The result is that I think it is rather the reverse, the notion, of course, known that Kant got into a situation in which empiricism on the one hand and rationalism on the other compromise and Kant then made a compromise between the two. Kant reconciled the dispute by introducing … what exactly? “ I absolutely agree.
I point to this in my text: „A very modern approach, since it includes the“ observer „as an experimental subject in the cognitive process. But Kant takes a“ third way „here. Instead of the materialistic-empirical monism of Hume and the idealistic-rationalistic substance dualism of Descartes, Kant would like to arrive at a transcendental-a priori dualism of properties and thus to a „transcendental psychology“.
Since your FB group „Kant in contemporary philosophy“ expressly refers in your statutes to the plurality of the Kant interpretation „To identify oneself as a member of the House of Analytic or the House of Continental is to ally oneself with one of these two branches of a common family tree. “ To explain my point of view, I would like to add the secondary literature of the Neo-Kantians (whether you want to see it analytically or continentally, leave it open) on this topic, which would be well worth further investigation on this exciting topic:
1. I find the article by Marcus Willaschek „Kant and the philosophy of the mind: To new books about mind and subject in Kant“ (https://www.uni-frankfurt.de/60971145/1997_Kant-und-die-Philosophie- des-Geistes.pdf) very readable, since it deals with the possible (modern) readings of Kant in relation to the philosophy of the mind (I just don’t know whether it is also available in English). According to Willaschek, the fact that Kant is neglected in terms of the cognitive science reading is due to the central question: „How synthetic judgments are a priori possible – an epistemological problem“. Of course, this would inevitably lead to antinomies again if one wanted to link Kant’s KrV to the a posteriori analytical judgments of the empirical sciences (see Kant’s initial problem, of which he was probably certain himself). Nonetheless, Kant also had to deal with the „human mind and its scope“, otherwise he would have had methodological problems, if only with regard to his dialectic.
2. It remains to investigate whether the nexus of „subjective deduction“ (A XVII) introduced by Andrew Brook („Kant and the Mind“, XII Cambridge Univ. Press, 1994) can be validated with regard to the cognitive processing of sensory stimuli . Brook even sees Kant as a forerunner of functionalism. [Well, maybe you don’t have to go that far.] Supposedly, other authors (Shoemaker, Dennett, Fodor) in the Paralogism chapter (152 ff.) See the „transcendental apperception“ as proof of the „synchronous identity of consciousness“ Meaning of a conception of a self-representing representation.
3. Perhaps it would also be worth considering – as Alejandro Rosas („Kant’s idealistic reduction. The mental and the material in transcendental idealism“, Königshausen and Neumann, Würzburg 1996) postulates – Kant’s transcendental idealism to solve the traditional „mind-body problem The distinction between a „rationalist“ and an „empirical“ perspective, which both have the same subject area, allows Kant to recognize both sides of the conflict as valid (5 ff.). “ (ibid. p. 8)
4. Heiner Klemme („Kant’s Philosophy of the Subject. Systematic and Developmental Studies on the Relationship of Self-Consciousness and Self-Knowledge“, IX, Meiner (Kant-Forschungen Volume 7), Hamburg I996) deals with the distinction between „rational and empirical psychology“ „due to the distinction between“ analytical and synthetic methods „in Kant. This is about a“ critical subject conception „in which the“ transcendental logic „is to be contrasted with the“ empirical „method. Another object of investigation should be the relationship between self-awareness („analogy model“) and self-knowledge („reflection model“), which should be illuminated with the help of „transcendental analytics“.
5. The main aim of my investigation, however, was whether a „third way“ might not succeed with Kant, which could lie between the „Cartesian dualism“ (matter vs. spirit) and the „Mach monism“ (matter = spirit), in form an ontology of transcendental idealism (spirit / matter / structure), the „transcendental bracket“?
But as you wrote, „Anyway, Mach’s empiricism is complicated.“ I can only agree with that because I have just noticed again that I was once again unable to achieve my initial goal of „keeping it short“. So I’m going to stop for now and thank you very much for your interest.
Many greetings
philosophies.de
Dear Mr. D. L.,
unfortunately, I am now also in a dilemma (and a real one), I would like to give you an answer to all of your objections, but then at some point we would be with the scholastic commentary on the comment, which on the one hand leads to endless circular conclusions and on the other hand to endless Time consumption. That’s why I just leave some things uncommented and limit myself to the – from my point of view – important things. Just as a supplement, not that you now think that individual things from your comment are unimportant to me. On the contrary, I like to take the points as constructive criticism. To structure my text a little better, I’ll break it down into points.
1. Dualism vs. Monism
In my opinion, these terms represent an attempt to structure the environment surrounding us in a very general way so that we (unfortunately I have to make a generalization here again, since „I“ as a single subject would be problematic in terms of formal logic) better observe / recognize / interpret / denote … (I intentionally use several predicates). From my point of view, this applies equally to rationalism and empiricism (hence the variety of predicates). This structuring in dichotomy or monotony (whether as substance or property or whatever) is in my opinion not a necessary, but only a sufficient condition for a correct description of the phenomenon or noumenon and for me actually only a symptom of the tendency in the Natural sciences but also humanities for methodical reduction. Interestingly, Kant himself refers to this problem in his texts:
„§ 113. Dichotomy and polytomy A division into two parts is called a dichotomy; but if it has more than two limbs it is called a polytomy. Note 1. All polytomy is empirical; the dichotomy is the only division from principles a priori – that is, the only primitive division. Because the members of the division should be opposite to one another and of every A the opposite is nothing more than non A. 2. Polytomy cannot be taught in logic; because this includes knowledge of the object. Dichotomy, however, only requires the proposition of contradiction, without knowing the content of the concept that one wants to divide. – The polytomy requires intuition; either a priori, as in mathematics (e.g. the division of conic sections), or empirical intuition, as in the description of nature. – But the division, based on the principle of synthesis a priori, has a trichotomy; namely, 1) the concept as the condition, 2) the conditioned, and 3) the derivation of the latter from the former. (Immanuel Kant: „Logic, II. General Methodology, II. Promotion of Perfection of Knowledge through Logical Classification of Concepts“
In this respect, I see Kant in a thoroughly „modern light“, also at the risk that you will not like this again, as a trailblazer for constructivism (even if only in a moderate form). But do not worry, I will not anachronistically abuse your Kant again, since I have found – in my opinion – better dissecting set for such mental dichotomies in systems theory.
2. The dichotomy „empiricism vs. rationalism“
I also consider this dichotomy to be absolutely obsolete, and I totally agree with you. As you correctly mentioned, Kant, Leibniz & Co. was probably alien to our current division into these categories, they might even have rejected it. As you correctly mentioned, Kant had either changed in his own biography (pre-critical – post-critical) or perhaps he found a „third way“ after all. In any case, I do not want to reopen this controversy, because for me it also has an over-long braid that has been parted for a long time. In the history of philosophy there is also a very exciting controversy on this topic, the „Duhem-Rey controversy“, to which I – provided that I am interested – may point out („https://philosophies.de/index.php/2020/11/12/from-physics-to-metaphysics/#From%20physics%20to% 20metaphysics).
3. Effects of the dualism „empiricism vs. rationalism“
But I find the effects of this controversy, which continues to this day, even more exciting. Since you mentioned authors from the philosophy of mind (Davidson, Fodor, Chalmer), you are familiar with this controversy in this area. Here is actually the „front line“ on which this „trench warfare“ (empiricism vs. rationalism) is being carried out, please forgive the martial form of expression, as a pacifist I also draw the comparison with a „sporting competition“ in the „UEPhA Cup Isms“.
I am also aware that in the Anglo-American area empiricism in the form of reductive materialism/ physicalism is actually en vogue. The results in this area are, to put it nicely, very sparse and modest and unfortunately – in my opinion – will remain so. The reductive-materialistic neurosciences tread on the spot because they want to explain the „spirit“ in a monistic and monocausal manner through „matter“ and either do not recognize or do not want to use concepts of the philosophy of spirit as empirically unsecured.
So I was surprised by your objection:“Philosophers who pretend to be making a scientific contribution to the field of neuroscience seem to be a cry for help.“
I see it the other way around: „Scientists who pretend to be making a scientific contribution in the field of neuroscience, without paying attention to the non-reductive, non-materialistic aspect of consciousness, seem to me to be in need of help!“
And philosophy can actually provide this help in the form of a non-reductive, bi-directional neurophilosophy as an equal partner on an equal footing. If you are interested in the topic, I recommend Georg Northoff in „What is neurophilosophy? A methodological account (2004)“ or „Minding the brain. A guide to philosophy and neuroscience.“ „Unlocking the brain. Volume 1: Coding / Volume 2: Consciousness.“ (2014) or as a short summary by Philipp Klar „What is neurophilosophy: Do we need a non-reductive form?“ (https://link.springer.com/article/10.1007/s11229-020-02907-6) or my next essays on this topic.
4. Get out of your armchair – into the world
If, in the end, I was allowed to be a little emphatic and enthusiastic:“Philosophy has to get out of its comfortable armchair and into the world!“ „We (for my part only I) urgently need a new metaphysics!“:
„The new metaphysics of nature distinguishes itself from the older essays in speculative metaphysics by being close to science: metaphysical claims are based on scientific theories. Consequently, the metaphysical claims about nature are as hypothetical as our scientific theories: there is no more certainty to be gained in metaphysics than here is in science. In other words, scientific knowledge claims are fallible and meta-physics, insofar as it draws on those claims, is as fallible as science.“(Elsfeld: „The Modal Nature of Structures in Ontic Structural Realism“(2009), p. 341)
Thank you for your interest and
best regards
philosophies.de (names are sound and smoke 😉
Dear Mr. D. L.,
Dear Mr. G. M. (nice that you have also joined our chat),
first of all, a comment on my own account, I would never have thought that my little article could generate such a response, but I’m happy about it. The only problem I have already mentioned is that I cannot go into all the points again, since I already have to answer two commenters. But I think that this problem – at least from my point of view – can be solved very quickly:
1. a) If I had published an article here with the content: „1 + 2 = 3“, we would certainly be done here. Or is there anything to add or perhaps to correct? Answers to this are very welcome.
b) If I had written an article that reads, „«Kater» (german idiom) are male cats.“ Then I would have written a very short essay, but the objections to this statement would have been rather minor. Although I could have been asked how I came up with the term „Kater“ and how I would have the certainty that the generic term „cat“, which generally applies to female species, can be assigned a „male“ adjective attribute.
c) When claiming: „Tri-colored «Kater» are always sterile.“ but it looks different. Here I would have been asked first of all about the empirical data for this claim. Thereafter, my underlying conclusions, with which I would have inductively or deductively inferred this claim, would have been called into question. Then one would first have to agree on the term „tri-colored «Kater»“ and ask about the ontology whether these actually existent entities („sensitive“) or only a logical-linguistic episteme („intelligible). Then one would have to be able to talk about whether this statement is meant phenomenological or empirical. And so on and so forth. And then you seriously claim that philosophy is not about * Linguistic concepts *? Okay, then not before I do another get longer replica of this.
This little example shows, however, how beautiful but also exhaustive philosophy can be and maybe explains why natural scientists prefer to withdraw/reduce themselves to empirical, ideally still mathematisable „data and facts“, which is of course absurd (please refer „Reduction“). If you are interested in this topic, it is presented in great detail in Adler, Joachim’s dissertation: „The concepts of the spirit“. 2014, University of Zurich, Faculty of Arts. (https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiyqrvdhOnuAhUZi1wKHZ6BCwcQFjAAegQIBhAC&url=z2Fuz.%3F .ch% 2Fid% 2Feprint% 2F135264% 2F1% 2FAdler_Dissertation_2014.pdf & usg = AOvVaw2btjvD8rdhWDHQ-ZbRRdSK)
By the way, Kant once expressed this very clearly in a nice comparison:
“But in what way can metaphysics be brought together with geometry in this business, since griffins are easier to connect with horses than transcendental philosophy with geometry seems to be able to? ”(ibid. W: 519 from https://brill.com/view/book/edcoll/9783957437761/BP000005.xml?language=de, p. 35)
Linking these „griffins with horses“ is one truly arduous „business“.
2. Dichotomies
Speaking of „griffins with horses“, the ontological and epistemological division into dualisms that you mentioned are already well known to me. The dichotomy with the help of the epistemic properties (a priori vs. a posteriori) or the semantic distinctions (analytical vs. synthetic) of judgments and their non-/sensual form (noumenal vs. phenomenal or intelligible vs. sensible) can also be summarized as: a priori-analytical-noumenal-intelligible vs. aposteriori-synthetic-phenomenal-sensible.
I am also familiar with the possibilities of a continuum of transitional forms à la Quine.
But why do we (pluralis modestiae) actually keep walking in the footsteps of great thinkers that have already been walked before us and not even going other, new paths? Kant opens up the possibility of polytomy for us. Why don’t we accept this offer?
And yes, with Th. S. Kuhn: „The Structure of Scientific Revolutions“ (1962) you are absolutely right. But if you do, you should let him have his say for once:
„For example, normal science often suppresses fundamental innovations because these necessarily shake their basic positions.“ (Ibid. P.20)
Then let’s (pluralis modestiae) let ourselves be shaken!
It was a great pleasure for me to exchange ideas with you about this exciting topic. But please forgive me if I have to exercise abstinence in further correspondence, since unfortunately I also have to go about other „business“.
Thanks for your interest
philosophies.de
Dear Mr. K. R.,
thank you for your comment and your opinion.
But I believe that this is actually only a linguistic problem, as the term is historically loaded and has the wrong connotations.
I mean actually a „naturalized metaphysics“ as described by Ladyman and Ross in their influential book „Every Thing Must Go: Metaphysics Naturalized“ (2009).
If you prefer to call it „metatheory“ or „metamethodology“ in front of me, then it might have to be a little more coherent.
The „over-view position“, if you may call it that, means an „observer position“ comparable to the experimenter in an experiment who does not want to disturb the measurement result by his observation (cf. „Schrödinger uncertainty relation“) ).
In the humanities, comparable statements would also be made that, in the sense of scientific realism, also have a claim to truth content, i.e. a reference to reality.
The dichotomy of „subjective“ vs. „objective“ does not make that much sense in the natural sciences either, since there the researcher is always involved as the subject of knowledge.
„Intersubjectivity“ tries to find statements about reality that can be shared by more than one subject.
If you are interested in the topic, I may refer you to my new essay „The Paradigm Shift“ (https://philosophies.de/index.php/2021/03/31/der-paradigmenwechsel/), as this problem is examined in more detail there.
I am only afraid that the scientific methodology, and in particular cognitive neuroscience, will not get any further with the problem of the emergence of the „first-person perspective“ of consciousness and that a joint venture will be required.
But thank you for your interest and all the best
philosophies.de
Mein lieber B.,
vielen Dank für Deinen Kommentar, den ich mit großem Interesse und Freude gelesen, so viel Beachtung für meine kleinen Texte bin ich gar nicht mehr gewohnt ;-). Ich dachte nur, Du wolltest mir eine Rezension auf meiner Webseite schreiben, so kann ich nur meine eigene Antwort veröffentlichen. Aber das ist ja schon mal schön, dass Dir meine „Geschichte“ gefallen hat ;-).
Da Du Dir so viel Mühe gemacht hast, möchte ich Deine Gedanken auch entsprechend würdigen und hierauf, wenn es erlaubt ist, ein wenig ausführlicher eingehen:
Zu 1 .): Richtig, im alten Griechenland existierten verschiedene Wissensstufen, die ich in meinem weiteren Artikel „Die Philosophie des Geistes“ (https://philosophies.de/index.php/2021/01/10/die-philosophie-des-geistes/), auf den ich hier gerne bei Interesse verweisen möchte, einmal versucht habe darzustellen.
Zu 2 .): Danke, dass Dir mein Text unter literaturkritischen Gesichtspunkten gefällt, aber ausgedacht ist er leider nicht. Das wäre schön dann, denn dann könnte ich ihn doch noch als Roman rausbringen ;-).
Vielen Dank für Deinen Hinweis zur Systemtheorie, mit der ich mich auch schon beschäftigt habe (soll übrigens im Zusammenhang mit dem Enaktivismus (Varela/Maturana) das Thema in meinem nächsten Essay werden). Aber das Thema „Emergenz“ ist nicht wirklich neu, sondern wurde schon 1879 von George Henry Lewes in seinem Buch „Problems of Life and Mind“ eingeführt.
Wenn Du mich allerdings fragen würdest, wie ich hierzu stehe, würde ich sagen, dass ich persönlich nicht so viel von Emergenz halte. Es ist – im wahrsten Sinne des Wortes – einfach ein Prinzip des Reduktionismus, das aber gerne als weitere Möglichkeit zum Materialismus und Dualismus als „alternativer Monismus“ bezeichnet wird. Meines Erachtens führt aber seine starke Simplifizierung letztendlich zu mereologischen Fehlschlüssen, die besonders in der Philosophie des Geistes augenscheinlich wurden. In der Philosophie des Geistes „schwebt“ dieser metaphysischer Begriff schon einmal wie der „Geist über der Materie“, da es zum Beispiel zu Donald Davidsons Hypothese des Supervenienzprinzips bis heute keinerlei empirische Befunde gibt. Also, verstehe ich Deine Vorliebe für Emergenz nicht, wenn Du doch so gegen Metaphysik (s. u.) bist ;-). Der Hinweis zu Descartes ist in den „new cognitive science“ eigentlich auch keine Erwähnung mehr wert.
Zu 3 .): Da gebe ich Dir und Descartes Recht. Nihilismus macht einfach keinen Spaß ;-).
zu 4 .): Also, wenn Du mit „dubiosen Geist“ die Pfeife von Ernst Mach gemeint hast, da war vielleicht ein bisschen zu viel „scharfer Tobak“ drin, der bei ihm – wie in meinem Essay beschrieben – auch sehr gut gewirkt hatte ;-). Klar haben die „Exorzisten“ vom „Wiener Kreis“ am Anfang des Jahrhunderts versucht die „Metaphysik“ mit ihrem „Abgrenzungskriterium“ auszutreiben (sorry für die Emphase, die absolut nichts mit Dir und Deinem Projekt zu tun hat, sie passte nur so schön ins Bild) und hatten auch hiermit leider eine sehr lange Nachwirkung auf die Wissenschaftstheorie bis zum heutigen Tage.
Selbst Karl Popper aber, bei dem man durchaus sagen kann, dass er dem Wiener Kreis durchaus nahe stand, hat meiner Ansicht nach eine „Abgrenzung“ in zweifacher Hinsicht versucht zu unternehmen.
Einerseits hatte er versucht sich mit seinem hypothetisch-deduktiven „Abgrenzungskriterium“, mit der Unterscheidung von Sätzen mit empirischem Sinn von solchen mit nicht-empirischem Sinn, in seinem Buch „Logik der Forschung“, sich ganz im Geiste seiner Zeit oder dem Drucke seiner „Peer-Group“ zum Bereich der Metaphysik abzugrenzen.
Andererseits sah er aber das Vorhaben des logischen Empirismus mit seinem positivistischen Ansatz der „Verifikation“ genauso kritisch, weil er hier das „Induktionsproblem“ richtig erkannt hatte, aber auch aus meiner Sicht die Grenzziehung zwischen wissenschaftlich sinnvollen und sinnlosen Sätzen für nicht aufrecht zu erhalten sah, da sie Grenzbereiche, wie vielleicht die Metaphysik einfach von vornherein ausschloss.
Ich möchte zum Beweise – wenn es gestattet ist – hier gerne einmal Popper selber länger zu Worte kommen lassen: aus Popper:
„Anders als früher denke ich nicht mehr, daß in diesem äußerst wichtigen Punkt zwischen Wissenschaft und Metaphysik ein Unterschied besteht. Eine metaphysische Theorie sehe ich nun ähnlich wie eine wissenschaftliche. Zweifellos ist sie unbestimmter und in vieler Hinsicht schwächer, und ihre Unwiderlegbarkeit, ihr Mangel an Prüfbarkeit, ist ihr größter Fehler. Aber, solange eine metaphysische Theorie rational kritisiert werden kann, wäre ich gewillt, ihren impliziten Anspruch, versuchsweise für wahr genommen zu werden, ernst zu nehmen. Und ich wäre bereit, vor allem diesen Anspruch zu erwägen und sie danach zu beurteilen, –zuerst prüfend, wie interessant sie vom Theoretischen her ist, und ihrer praktischen Brauchbarkeit (im Unterschied zu ihrer Fruchtbarkeit als Forschungsprogramm) dabei nur ein sekundäres Interesse schenkend. Wichtig mag praktische Verwendbarkeit oder Wertlosigkeit vor allem dann sein, wenn das so etwas wie ein Wahrheitstest ist, – so wie das bei einer wissenschaftlichen Theorie oft der Fall ist.
Aber ist es denn möglich, eine Theorie rational zu beurteilen oder zu bewerten, die unwiderlegbar ist? Worin liegt der Sinn, eine Theorie rational zu kritisieren, wenn wir doch von Anfang an wissen, daß sie weder mit reinen Vernunftgründen widerlegbar noch anhand von Erfahrungen prüfbar ist?
Meine Antwort darauf ist: Wenn eine metaphysische Theorie eine mehr oder weniger alleinstehende Behauptung ist, wenn sie nicht mehr ist als eine Ahnung oder ein Einfall, der uns mit seinem »nimm oder laß mich« kommt, dann mag eine rationale Diskussion wohl unmöglich sein. Dasselbe würde aber auch für eine »wissenschaftliche« Theorie gelten.“ (Karl Popper: „Die Quantentheorie und das Schisma der Physik“. Kapitel 27: Offene Probleme, S. 229 ff.)
Und wenn der das schon sagt, dann müsste doch vielleicht auch etwas dran sein ;-). Und wo, wenn nicht in einer FB-Gruppe zum „Deutschen Idealismus (Philosophie)“ sollte man einmal frei und offen über Metaphysik sprechen dürfen, ohne gleich als „völlig verrückt“ erklärt zu werden, sonst wäre man doch lieber Mitglied in der FB-Gruppe „Logischer Empirismus (Wissenschaft)“.
Aber das „böse“ Wort „Metaphysik“ ist scheinbar mit einem kultur-historischen „Pawlowschen Reflex“ ausgestattet. Bei „Metaphysik“ geht bei den meisten Leuten das „Kopfkino“ mit dem Filmen „Hegel auf der Blumenwiese beim Pflücken hermeneutischer Blüten“ oder „Moses auf dem Berge Sinai und der Verkündung der 10 Geboten“ an.
Diese Konnotationen des Begriffs lassen sich wahrscheinlich auch nicht mehr umdeuten. Deshalb wäre ich eigentlich auch lieber für den Begriff „Metatheorie“, wie sie zum Beispiel die „Systemtheorie“ zu benutzen pflegt, die Du ja auch schon bekundet hast zu kennen. Weil eigentlich geht es in der „Metaphysik“ doch um mehr als nur um das „hinter der Physik“, was ja auch eher als ein „hinter der Physis“ gemeint ist.
Ich glaube, dass besonders die modernen Naturwissenschaften dringender denn je eine neue Metatheorie benötigen. Sie blenden nur dieses unliebsame Thema und andere Meinungen einfach aus. Ich würde mal sagen hier findet die Falsifikation definitiv nicht statt und dies ist für mich ein weiterer schlagender Beweis, dass Kuhn mit seinen „normal science“ und „scientific revolutions“ doch Recht hatte. Man muss leider konstatieren, dass der wissenschaftliche Realismus ist in dieser Form gescheitert ist, da es nur um Geltungsanspruch und Machtbesitz und nicht um Erkenntnisgewinn oder Wissenszuwachs geht.
Ich muss jetzt aber mal wieder einen Stopp machen, weil ich sonst wieder zu sehr ins Fabulieren (s. o.) gerate und das hier auf FB wieder tl:dr ist, sorry.
Vielen Dank für Dein Interesse und
liebe Grüße
philosophies.de
Dear Mrs. Y. T.,
thank you for your comment, but metaphysics are no „contradiction“, they are simply after the reality and experience of physics (gr. „meta-physics“ -> eng. „after-physics“) 😉.
I think I understood you very well. You can, as you have suggested, use metaphysics to check the difference between two empirical results, since metaphysics is actually nothing other than the „metatheory of a science“.
The philosophical basis or the methodological substructure of a scientific discipline, if you will. So don’t be „afraid“ of metaphysics 😉.
Many greetings
philosophies.de 🙋
Dear L. B.,
thank you for your friendly compliments, but you are also something special because, unlike many others, you are interested in these topics. I would therefore like to try to answer your good questions.
To your 1st question: „Would you agree there is a ‚human spirit‘? I think you are saying, or would say this translates into ‚mind.‘ Is this so? “ In fact, I would rather prefer the term „mind“ or „consciousness“ as it is a bit more tangible than „spirit“ and „soul“. I just can’t deny that I come from the scientific corner and would rather try to convince with empirical induction than with logical deduction. Nevertheless, I have absolutely no objection to people believing in a „spirit“ or a „soul“. Only these entities are very difficult to prove empirically. Conversely, however, that doesn’t mean that they don’t exist. If you ask me personally, I would say, „yes“ there is a human „spirit“ and „soul“, otherwise we would not sit here and think about such things, write and positively reinforce each other in a friendly manner 😉
To your 2nd question: „So, ’spirit‘ and ’soul‘ are transcendental terms, which firmly come into the domain of religion?“ For the reasons mentioned above, I would answer with a resounding „yes“. Loosely based on the biblical quote (Luke 20:25): „So give to the sciences what is to the sciences (mind / consciousness) and to the religions what is to the religions (spirit / soul).“ 😉
I hope I could help you. And thank you again for your interest.
Many greetings
philosophies.de
Lieber A. R.,
vielen Dank für Ihren weiteren, sehr interessanten Kommentar.
Wenn es mir gestattet ist, würde ich gerne auf Ihre Hinweise ein wenig ausführlicher eingehen.
Ihren Hinweis auf Platons Ideenlehre und den daraus resultierenden Dualismus im „Universalien vs. Nominalismus“-Streit sehe ich allerdings genauso kritisch, wie der sich daraus später entwickelnde Dualismus im „Empirismus vs. Rationalismus“-Streit oder moderner „Realismus vs. Antirealismus“-Streit.
Man kann hier eine über die Jahrhunderte gehende Bruchkante in der „Archäologie des Wissens“ freilegen, wie ich dies einmal in einem weiterführenden Essay „Der Paradigmenwechsel“ (https://philosophies.de/index.php/2021/03/31/der-paradigmenwechsel/) versucht habe nachzuzeichnen.
Wie Sie richtig hinweisen, sind natürlich Plato oder Descartes nicht die Begründer des Dualismus. Ich glaube allerdings auch nicht, dass sie ihn aufgedeckt haben, sondern dass die Gründe für die Dichotomisierung der Welt („gut vs. böse“, „heiß vs. kalt“, „schwarz vs. weiß“,…) eigentlich eher evolutionsgeschichtlicher Natur sind.
Eine mögliche, nachvollziehbare Begründung für die Entstehung des Dualismus als epistemologische Ordnungsgröße liefert der Stammvater der evolutionären Erkenntnistheorie Rupert Riedl. Er sieht in dem Dualismus eine Anpassungsstrategie, die aus evolutionärer Sicht eine kognitive Erfassung der Welt durch Kategorisierungen erst ermöglicht hat. Riedls biologisch-evolutionärer Ansatz geht davon, dass die Dichotomien in unserem Weltbild:
“keineswegs zu Zwecken der Erkenntnis dieser Natur geschaffen worden, sondern zum „Zweck des Überlebens. Und für dieses Überleben genügt es, in diese Welt hinein gewisse Sinnesfenster zu besitzen… Und in derselben Weise besitzen wir offenbar auch eine Vorstellung von dem, was wir Materie nennen, und Strukturen gegenüber dem, was wir als Vorgänge erleben oder allgemein als Funktionen… Wir haben also für Strukturen und Vorgänge zweierlei, zunächst inkomparable Begriffe… So dass wir zwar offensichtlich vor einer einheitlichen Welt stehen, aber mit zwei erblich getrennten Sinnesfenstern und die Verbindung zwischen ihnen erst mit Mühe konstruieren müssen.
[…] Wir müssen unsere geteilten Anschauungsfenster zusammenführen und gewissermaßen probeweise beginnen mit einer Synthese, einer Zusammenfügung, unseres so lange gespaltenen Weltbildes“, um so die rationalen Fehler zu vermeiden, die wir aufgrund unseres ererbten dualistisch geprägten Anschauungssystems begehen. (Rupert Riedl: “Kultur – Spätzündung der Evolution? Antworten auf Fragen an die Evolutions- und Erkenntnistheorie.” 1987, S. 79–85, 294 –200 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Dualismus#cite_note-7)
Diese „rationalen Fehler“ zu vermeiden halte ich für unabdingbar für einen wissenschaftlichen Forstschritt zum Beispiel im Bereich der kognitiven Neurowissenschaften aber auch für einen überlebenswichtigen Schritt hinsichtlich der Risikofolgenabschätzungen bezüglich der KI-Forschung.
Vielen Dank für Ihr Interesse und
viele Grüße
philosophies.de 🙋
Dear P. R.,
thank you very much for your very kind comment, which I read with great interest.
Your reference to the phenomenon of „qualia“, which has led to a dilemma in cognitive neuroscience but also in the philosophy of mind, is better known. Likewise the classic doctrine that this problem can be explained simply with the help of a metaphysical construction in the form of „emergence“ (Chalmers).
Unfortunately, no empirical findings for verification in brain research could be found for this reductionist-materialist approach far beyond the identity theory (place/smart). It has been proven that there are no correlations whatsoever between physical-neuronal states and any resulting psychological-mental states. In short, there is no demonstrable „consciousness in the brain“.
For over 2000 years, cognitive neuroscience and the philosophy of mind have simply chased a „ghost“ that Plato wanted to catch in his substance dualism as a „ghost buster“, because it is simply a pseudo problem . It is quite simply a misconstruction in the way of thinking that is based on a dualistic, neurocentric worldview. Therefore all attempts end in a dead end.
Funnily enough, research on consciousness gets support from AI research, of all things. Therefore your reference to the potential of the „markov blankets“ is absolutely correct. In my opinion, however, it would have to be supplemented by a „polycontextural logic“ (Gotthardt Günther). Then, however, I see no more reasons why a strong AI with something like a „machine awareness“ could not develop from this, with far-reaching risky consequences. All it takes is structure.
I already have a further essay on this topic „The system needs new structures – not only for / against Artificial Intelligence (AI)“ (https://philosophies.de/index.php/2021/08/07/das-system-bendet-neue-struktur/), which I would like to point out to you. You are of course also cordially invited to leave me a comment on my page.
Thank you also for your reference, which I was already aware of.
I have already read a lot about the many great, colorful pictures of the fMRI and the possible combination with the EEG and am also in a lively exchange with a neuroscience student who unfortunately has the unpleasant task of evaluating this fmri data. He was able to tell me some exciting things about this.
Unfortunately, it does not change the fact that there is definitely an explanation gap. The fact that certain specific NNs in the brain appear to be activated by the color red on the fMRI scan does not say anything about their informational content. There are even alleged „evidence“ of brain research (Andrew Newberg) or so-called neurotheologists (Michael Persinger) who, with the help of the computer tomograph, could have represented God as a „neuronal structure“ in the NN. Sorry, just because a light bulb lights up when I press a light switch, it doesn’t say anything about the state of the light bulb, the light energy, the color of the light, the warmth of the light, the symbolism of the light.
But I absolutely agree with your hint that „Conscious is like music“. Georg Northoff, one of the leading neurophilosopher and cognitive neuroscientist in this field, once compared the constitution of consciousness to the „synchronization of a tapping foot to music“. In his „temporo-spatial theory of consciousness“ (TTC) he also assumes a „nestedness of consciousness“ due to its „spatio-temporal correlation“. He was able to prove this in numerous studies with empirical findings. At this point I would like to refer you to a video interview that I was able to conduct on this topic with Prof. Northoff (https://philosophies.de/index.php/2021/08/18/interview- mit-prof-dr-georg-northoff /).
Thank you for your interest and
best regards
philosophies.de
Dear Mr. R. H. M.,
thank you very much for your kind comment and your willingness to deal with this topic, which does not seem to be taken for granted, as I could see from another comment in this group.
Of course, your reference is not only absolutely justified, but also correct. In my little essay it was not about presenting the dichotomy or the dualism as given, but on the contrary, I am concerned with overcoming the dualism that has been known for over 2000 years, which is already documented in Plato’s substance dualism.
This has only led to a dead end in the history of science. As a concrete example, this can be illustrated very nicely in the history of the philosophy of mind, but also in cognitive neuroscience. I have tried to prove this in other essays, which I would like to point out to you at this moment (https://philosophies.de/index.php/category/wissenschaftstheorie/).
And with regard to your reference, yes, I also think that one would rather assume a non-physical nonduality in the sense of a structural polycontexturality.
Thank you for your interest and
best regards
philosophies.de
Lieber M. M.,
vielen Dank für Ihren freundlichen Kommentar und auch für das Teilen meines Beitrages.
Ich zähle mich allerdings auch lieber zu den „normal interessierten Menschen“; Nerds werden doch auch immer irgendwie anstrengend ;-).
Einerseits kann ich Sie in Ihrer Meinung nur unterstützen, da für mich die „«Trennung» von Geist und Materie“ ebenfalls nur eine künstliche Dichotomie ist und zu einem bis heute nicht lösbaren Pseudo-Problem führt. Wenn man die beiden Enden einmal getrennt, wird sie auch in ferner Zukunft nicht wieder zusammen bekommen.
Ich würde allerdings nicht soweit gehen alles auf den „Energie“-Begriff zu reduzieren, da man sich damit ein neues nicht-zuhintergehendes, metaphysisches Problem schafft. Wenn den Energiebegriff auf alles anwenden möchte, müsste man zunächst einmal ein klares, ontologisches Konzept von Energie haben. Das ist in der Physik schon nicht so einfach, aber erst schwierig wird es, wenn man es auf immaterielle, nicht-physische Dinge versucht anzuwenden. Da bekomme ich irgendwann ruckzuck Probleme mit der Empirie und dann ist es doch nur wieder eine Spekulation.
Ihre Erklärung über eine „Matrix“ wirft bei mir zunächst einmal das „Kopfkino“ für die
Machowski-Filme an, die ich übrigens absolut super finde und mich schon auf den 4. Teil freue.
Ihre weiteren Beschreibungen der „Matrix“ kann ich leider aber nicht mehr so gut nachvollziehen, aber möglich könnte dies alles sein, allerdings fehlen hier dann wieder die Beweise.
Wenn Sie allerdings mit Matrix vielleicht so eine Art Strukturenrealismus meinen, mache ich auch gerne mit. Die zu anfangs genannten Problemen ließen sich nämlich m. E. prima über den Strukturenrealismus lösen, dann bräuchte man auch keine Energie- oder Materie-Konzepte und die Empirie käme hier auch zum Zuge.
Aber wer weiß, vielleicht ist es ja doch alles nur ein starkes anthropisches Prinzip und ich sollte doch lieber die „rote Pille“ schlucken ;-).
Vielen Dank für Ihr Interesse und
viele Grüße
An unseren heutigen philosophischen Ansichten, hiesigen Beiträgen und der heutigen politischen Lage, kann man sehen, welche schädlichen Folgen die falschen Begriffe der ALTEN, die sich “ Philosophen“- und uns „MENSCHEN“- nannten, mit ihren damaligen Gedanken noch heute zeigen – und dass sie gar nicht klar erkannten, was sie da liebten und „WAHRHEIT“ nannten. Und auch die Gottegläubigen bleiben ohne gelebte Wahrheit allein, bei der Bestimmung des menschlichen Sein. Das heißt logisch, Gott kann nur die philosopphisch denkbare „Vollkommenheit alles Wahren“ sein, denn diese Vollkommenheit der Wahrheit verbindet alles was ist, so scheint und sein wird.
Lieber B. J.,
vielen Dank für Deinen freundlichen Kommentar, den ich mit großem Interesse gelesen habe.
Ich würde gerne kurz auf Deine Frage eingehen, wenn ich darf.
Ich gebe Dir absolut Recht hinsichtlich des Konstruktionsfehlers in der Wissenschafts- und Philosophiegeschichte alles auf solche Dichotomien von „Geist vs. Materie“, „Gehirn vs. Körper“, „Körper vs. Umwelt“, etc. pp. als Dualismus reduzieren zu wollen.
Ich denke hier auch eher an eine strukturale Polytomie der Realität, allerdings mit dem Unterschied, dass man hierzu keine neuen „Seinsformen“ als Entitäten benötigt, sondern dass die Wirklichkeit schon in den strukturalen Relationen im Sinne eines Strukturenrealismus enthalten ist. Insofern kann ich Deinen Vorschlag: “ E s g i b t vielleicht doch Zwischendinge“ nur unterstützen.
Falls Dich das Thema interessiert, kann ich Dir meine Folge-Essays in https://philosophies.de/index.php/category/erkenntnistheorie/ empfehlen.
Vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit und
viele Grüße
Impuls zu Ernst Mach:
Ernst Mach, Analyse der Empfindungen, Jena 1900:
„An einem heiteren Sommertage im Freien erschien mir einmal die Welt samt meinem Ich als eine zusammenhängende Masse von Empfindungen, nur im Ich stärker zusammenhängend.“
‚Der Physiker‘ (M.R. aus ‚Das Leben liegt in den Zwischenräumen‘, Berlin, 2006/2013):
„…Es war einmal ein Physiker, der die Welt gewissenhaft auf physikalische Weise zu erforschen suchte. Da geschah es eines schönen Sommertages, dass dieser ernsthafte und kluge Mann in seinem Garten stand, für Augenblicke nur da stand und atmete und schaute. Der laue Wind strich ihm sanft über die Haut, die Blumen veräußerten verschwenderisch ihren Duft, schwelgten in ihrer Farbenpracht, die Vögel jubilierten, die Insekten schwirrten, summten um ihn herum, und das Ganze kam ihm vor wie ein einziger wundervoller Tanz des Universums.
Der Wissenschaftler schloss die Augen. Die Zeit stand still, die Grenze zwischen ihm und dem, was ihn umgab, verschwamm, und er hatte das Empfinden, eingebunden zu sein in einen überall wirkenden Zusammenhang, eins zu sein mit dem Kosmos!
Nun hatte der kluge Mann Ähnliches bisher nur von Mystikern gehört.
– Was habe ich mit einem Mystiker zu tun?, dachte er bestürzt und fuhr fort, noch gewissenhafter über alles nachzudenken und kam zu dem Schluss, dass das, was er erlebt hatte, so in Wirklichkeit nicht sein konnte: es gab weder Licht noch Farben, weder Gerüche noch Vogelgesang; die ganze empfundene Welt existierte nur scheinbar. Stattdessen war die Erde bevölkert mit wenigen Elementen, die sich schwarz, kalt und lautlos bewegten und in eigenartiger Abhängigkeit voneinander standen, mal in flüchtiger, mal in fester Verbindung, an bestimmten Stellen mehr oder weniger zusammenhängend. Ja, davon war er jetzt überzeugt und schrieb ein neues wissenschaftliches Werk…“
Was will ich sagen? Die Beschäftigung mit Metaphysik ist keine intellektuelle Spielerei, eher gebotene Disziplin des Denkens,
Unsere allgemeinen, vorgefassten Grundannahmen, unsere (Welt-)Anschauungen – auch wenn sie uns nicht immer bewusst sind – beeinflussen unser ganzes Leben, bestimmen unser Denken, unsere Vorstellungen, Empfindungen, Wahrnehmungen, ja verhindern oder ermöglichen überhaupt erst das Zulassen, Gewahrwerden und Ernstnehmen bestimmter Wahrnehmungen: wir sehen, anerkennen letztlich nur, was wir bereits erwarten; wir glauben nur, was wir im Vorfeld gewillt sind zuzulassen, zu akzeptieren. Es lohnt, unsere still schweigend gemachten, unkontrolliert wuchernden Grundannahmen immer wieder neu zu überprüfen, womöglich zu korrigieren, zu erweitern.
Das geht nur auf Meta- Ebene, meta-physisch.
Fazit: Ernst Mach konnte das überwältigende Erlebnis im Garten nicht mit seinem (engen) materialistischen Denkansatz vereinbaren, nicht einordnen; so hat ihn das Erlebte zwar bewegt, im Nachhinein sogar sein Denken beeinflusst, m.E. unzureichend.
Liebe Frau Reinecke,
vielen Dank für Ihren ausführlichen Kommentar, den ich mit großem Interesse gelesen habe.
Mir war zwar der Auslöser von Machs Sinnesphysiologie und wissenschaftlichen Erkenntnistheorie geläufig, aber Ihr freundlicherweise zur Verfügung gestelltes Zitat bringt die ganze Sache noch einmal schön auf den Punkt, woher Herr Mach seine „Eingebung“ bezogen hatte.
Auch Ihren Hinweis „Beschäftigung mit Metaphysik ist keine intellektuelle Spielerei, eher gebotene Disziplin des Denkens“ kann ich nur voll und ganz unterstützen. Ich sehe in der Metaphysik auch etwas über oder hinter der wissenschaftlichen Physik Liegendes und Begründendes.
Oder um Herrn Kant mal wieder mit seinem bekannten Zitat zu bemühen: „Gedanken ohne Inhalt sind leer. Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ Daher ist es auch so wichtig, wie Sie richtig geschrieben haben, sich einmal einen Begriff von seinen (Welt-)Anschauungen zu machen, damit man nicht „blind“ durch die Gegend läuft und „leere Gedanken“ produziert. Die moderne Naturwissenschaft hat hier tatsächlich einen „blinden Fleck“, der mit Hilfe der Metaphysik erhellt werden könnte. Hier ist tatsächlich noch viel „Luft nach oben oder dahinter“.
Vielen Dank für Ihr Interesse und
viele Grüße
Dirk Boucsein
Vielen Dank, Dirk Boucsein, für Ihr freundliches Feedback… Bevor es weitergeht: für die Anrede ‚Maria Reinecke‘ wäre ich dankbar.
Herzliche Grüße aus Berlin
Maria Reinecke
Holà, Dirk Boucsein,
wenn Sie erlauben, zwischendurch ein vielleicht/hoffentlich zusätzlich Lust machender Sprung direkt hinein in Whiteheadsches Denken, das auf vier Grundprinzipien basiert – vorab zur Einordnung für interessierte Mitleser:
Das ontologische Prinzip:
Die elementarsten Tatsachen sind wirkliche Ereignisse; wirklich ist, was geschieht; außer Geschehnissen gibt es nichts; wirkliche Ereignisse sind Erfahrungsereignisse; Erfahrung ist das Grundelement der Wirklichkeit.
Das Prinzip des Prozesses:
Der Prozess ist das Werden von wirklichen Ereignissen; wirkliche Ereignisse gehen als raumzeitliche ‚Erfahrungstropfen’ in den Prozess ein. Im Prozess vollzieht sich die Wirklichkeit. Der Prozess ist die Wirklichkeit.
Das Relationalitätsprinzip:
Wirkliche Ereignisse vollziehen sich in universeller Verbundenheit mit und in Abhängigkeit von anderen wirklichen Ereignissen; die Natur ist ein grenzenloses Energie-Beziehungsgeflecht wirklicher Ereignisse.
Das Prinzip der Wirk- und Zweckverursachung:
Jedes wirkliche Ereignis ist in seinem Prozess des Werdens sowohl aktiv erfassendes und bewirkendes Subjekt als auch erfasstes und bewirktes Objekt, Datum für andere wirkliche Ereignisse; (weder nur Subjekt noch nur Objekt, sondern ‚Superjekt’); ein einzelnes Ereignis ist wirklich, wenn es für sich selbst Bedeutung hat; es begründet sich durch seine konkrete Wirksamkeit selbst; es strebt in seinem Werden nach Erfüllung; sein Empfinden hat Vektorcharakter: es zielt als Ursache auf die Wirkung.
Beispiel: Bestäubungsvorgang als ‚Ereignis‘ aus prozessphilosophischer Sicht
(M.R. aus „Ereignishaftigkeit von Natur“, 2012)
… Auf dem Wege durch den Tiergarten entdecke ich auf einer Wiese einen Kirschbaum, um dessen rosa Blüten eine Hummel kreist. Ich gehe näher heran, bleibe stehen und werde überraschend Zeugin von der Ereignishaftigkeit eines Bestäubungsvorganges – allgemein definiert als ‚Übertragung von Pollen durch Insekten auf die Narbe von Blüten’.
In diesem Augenblick aber, an diesem Ort wird der bloße Ablauf zu einem einmaligen Ereignis zwischen zwei intensiv interagierenden, symmetrisch aufeinander bezogenen, sich aufeinander einstellenden Wesen: dieser Blüte und dieser Hummel. Die Blüte bietet sich in ihrer weiß-rosafarbenen Pracht dar; sie duftet verlockend und streckt ihre leuchtenden Blätter vibrierend aus. Die Hummel nimmt ihren Glanz, ihren Duft wahr, versucht, mehr davon zu bekommen, schwebt, bewegt sich vorsichtig auf die Blüte zu, umkreist sie, tastet sich schnuppernd vor, lässt sich sanft auf ihr nieder. Und es beginnt der abenteuerliche raumzeitliche Prozess eines konkreten intimen Stoffwechselaustauschs zwischen dieser Hummel und dieser Kirschblüte; beide individuellen Entitäten begegnen, präsentieren sich mit ihren spezifischen Farb- und Duftstoffen, Geruchs- und Geschmacksorganen; verschmelzen mit ihren Säften, Stoffen, tauschen sich bis in die molekularen, atomaren Bereiche hinein wechselseitig aus, erfahren Veränderung, bilden sich neu: ein Ereignis, das für sie beide wesentlich konstitutiv ist und auf das sie angewiesen sind. Hummel und Kirschblüte befinden sich so in ständiger Kreation, und die Natur, die Welt und wir um sie herum gleichermaßen…(M.R. frei nach einem Beispiel aus dem Essay: „Über Whitehead und Mead zur Aktor-Netzwerk-Theorie: Die Überwindung des Dualismus von Geist und Materie…“, B. Gill, 2007).
Was ist mit mir währenddessen geschehen?
Mein subjektives Empfinden ist in der Unmittelbarkeit dieses Bestäubungs-Ereignisses verwurzelt. Was sich da gerade vor mir ereignet hat, geht als objektives Datum in mich ein, bewegt mich, verändert mich spürbar, und ich gehe neu gestimmt weiter…
Pause.
Danke
Hallo Maria Reinecke,
vielen Dank für Ihren ausführlichen Kommentar und die interessanten Ausführungen zum Whiteheadschen Denken, dem ich bestimmt auch noch einmal einen Extra-Essay widmen werde.
Ich sehe hier tatsächlich Möglichkeiten gegeben mit Hilfe der Prozessphilosophie z. B. die Konstitution von Bewusstsein besser beschreiben zu können, da dieses ebenfalls aus meiner Sicht als einen struktural-dynamischen Prozess gesehen werden kann. Der Strukturenrealismus bildet hierbei ganz gut die strukturalen Elemente ab und die Prozessphilosophie könnte vielleicht ein Hilfsmittel sein, um die Dynamik besser abzubilden. Dies müsste man mal überprüfen.
Noch einmal vielen Dank für den Tipp und
viele Grüße
Dirk Boucsein
Nachtrag für Literatur-Interessierte: Ernst Machs psychophysischer Monismus/Empiriokritizismus bildet u.a. den erkenntnistheoretischen Hintergrund in Robert Musils Roman ‚Der Mann ohne Eigenschaften‘; z.B. Kapitel ‚Atemzüge eines Sommertages‘; ‚taghelle Mystik’… (s. auch Robert Musils Dissertation: ‚Beitrag zur Beurteilung der Lehren Machs‘)
etc.
Habe ich etwas übersehen beim Durchforsten Ihres großartigen Blogs?
Ich vermisse A. N. Whiteheadse Prozessmetaphysik, m. E. DIE Metaphysik des XX. und XXI. Jahrhunderts…(‚Prozess und Realität‘, 1929) Whitehead, Mathematiker, Naturwissenschaftler, erst später Philosoph entwickelt auf dem Hintergrund eines ‚modernen‘ wissenschaftlichen Weltbildes des 20. Jahrhunderts das Paradigma einer relationalen, organischen/organismischen, prozessualen Weltsicht und ermöglicht so ein neues Verständnis von Wirklichkeit…
Es geht bei Whitehead gerade um die Neudefinition von Subjektivität und Objektivität bzw. um deren Überwindung; es geht um Kreativität, Einmaligkeit und um das „Seiende“, bei ihm nicht statisch als gegebene Substanzialität, sondern als dynamisches, prozessuales Werden in notwendiger Relation, Wechselwirkung, Kommunikation… zu und mit anderem.
Whitehead trifft wesentliche Grundentscheidungen gegen die Dichotomien festgefahrenen philosophischen Denkens: gegen die Spaltung von Materialismus und Idealismus; gegen die Trennung zweier Seinsbereiche von Natur und Geist und dem damit verbundenen Erkenntnisideal einer „rein objektiven“ Naturwissenschaft im Gegensatz zu den Geisteswissenschaften; gegen die Trennung von Leib und Seele, Körper und Geist; gegen jede wissenschaftstheoretische Reduktion geistiger Prozesse auf Materielles…
Sorry, vielleicht finde ich ihn hier ja doch noch…
Gruß aus Berlin
Hallo Frau Reinecke,
nochmals vielen Dank für das Kompliment, Ihren sehr aufschlusreichen Kommentar und Ihren interessanten Hinweis zu Whitehead.
Ich muss leider gestehen, dass ich Whitehead noch immer nicht ausreichend in meinem Blog gewürdigt habe, er aber ganz oben auf meiner todo-Liste steht. Es hatte sich bisher noch kein direkter thematischer Zusammenhang zu seiner Prozessphilosophie ergeben. Ich hatte ihn nur schon einmal als Antwort auf verschiedene Kommentar erwähnt, wie z. B.:
„Zu Ihrer These: „dass der Grundfehler des Materialismus folgender ist: Die Verneinung eines aktiven Prinzips in der Welt/Natur.“
Dies trifft aus meiner Sicht den Nagel sehr gut auf den Kopf und ich kann Sie hierin nur bestärken. Die Reduktion von komplexen Vorgängen auf statische, lineare Modelle bestehend aus Einzelteilen macht leider auch den Zusammenhang des Ganzen im Sinne eines mereologischen Fehlschlusses kaputt. Ich hatte dies einmal als Konstruktionsfehler des Reduktionismus, der als wissenschaftlichen Methodik scheinbar als „genetischer Bauplan“ von Forschergeneration zu Forschergeneration weiter gegeben werden scheint, versucht nachzuweisen.
Prozessphilosophien eines Alfred North Whitehead, oder auch aktueller eines Nicholas Rescher, harren weiterhin darauf endlich einmal eine Berücksichtigung auch hinsichtlich der Metaphysik der Naturwissenschaften zu finden. Schade, aber gute Ideen lassen sich nicht einfach aus der Welt schaffen, sie werden sich auch irgendwann einmal durchsetzen.“
Alfred North Whiteheads, aber auch Nicholas Reschers Metaphysik bieten m. E. noch spannende Ansätze, um z. B. mit Hilfe der „actual entity“ (AE) zu einer präziseren Beschreibung der dynamisch-prozessualen Struktur von „Bewusstsein“ zu kommen. Das könnte auch für eine strukturenrealistische Beschreibung des Phänomens „Bewusstsein“ ganz hilfreich sein, da man sich hier durch die Verschiebung des Fokus auf den reinen Prozess von den materiellen Entitäten lösen könnte, die sowieso immer nur in die „Sackgasse“ Dualismus führen. Also so etwas in dieser Richtung hatte ich auch schon einmal angedacht, aber bisher noch nicht komplett ausformuliert. Werde ich aber bestimmt beizeiten noch nachholen. Daher, wenn Sie ihn jetzt „noch nicht gefunden haben“, wird sich dies bestimmt bald geändert haben.
Vielen Dank für Ihr Interesse und
schöne Grüße aus dem Münsterland
Dirk Boucsein
Holà, an alle Philosophes,
nachdem ich mir noch einmal die Wahrheitsfrage bei Kant (in seiner Transzendentalen Logik) angeschaut habe, bekomme ich Lust, stichwortartig, eigenbrödlerisch allgemein gehaltene Gedanken, (provokante) Thesen, Fragen zu Kant im weitesten Sinne mit Ihnen zu teilen, mit einem kurzen vollmundigen Plädoyer für eine neue Metaphysik zum Schluss – in der Hoffnung, mit Ihnen unbekannterweise irgendwie ins Gespräch zu kommen:
1.
Was sich seit Kant ‚Aufklärung‘ nennt, sei letztlich ein Prozess der Demarkation, sagen Hartmut und Gernot Böhme in ‚Das Andere der Vernunft‘, 1985: die Vernunft zog sich auf ihr vermeintlich sicheres Terrain zurück, grenzte sich selber ein, anderes aus und produzierte/disqualifizierte so durch ihren Rückzug zugleich ihr Irrationales.
2.
Kants Selbstbeschränkung der Vernunft wurde in der Folge von dem philosophischen und naturwissenschaftlichen Denken radikalisiert (s. z.B. die Wahrheitsfrage bei Tarski) und hat zu einem verkürzten Vernunft- und Wissenschaftsbegriff geführt, der den Kultur- und Wissenschaftsbetrieb bis heute weitgehend bestimmt.
3.
Wir haben auf der einen Seite unser intuitives Wissen, unsere Alltagserfahrung, dass Natur voller Leben ist, und es gehört zu unserem zivilisatorischen Selbstverständnis, Sinnhaftigkeit und Werthaftigkeit von Natur in unsere ästhetischen und moralisch-ethischen Vorstellungen, Ziele, Handlungen mit einzubeziehen. Auf der anderen Seite steht abgespalten davon eine ‚wertefreie‘ Wissenschaft, die Natur als einen neutralen Prozess bloß ablaufender Aktivitäten beschreibt und jegliche Wirk- und Zweckverursachung lebendigen Selbstseins, jede aktive Realisation von Werten unberücksichtigt lässt.
Was dem Wissenschaftler als lebendige Gesamtheit der Natur-Mannigfaltigkeit unmittelbar als Vorwissen und Vorerfahrung (Alltagserfahrung) bekannt ist, wird bewusst vernachlässigt, abgespalten, seziert, auf Formeln reduziert und erst nach Kontrolle und Selektion im Labor als wissenschaftliches Datum anerkannt. Das am Exaktheitsideal der Naturwissenschaft orientierte Denken, das Aufgehen in Abstraktionen und die Verabsolutierung des Kausalitätsbegriffs sollen Objektivität garantieren. Hoch spezialisierte Einzelwissenschaften beschränken sich auf ihre Forschungsgebiete; Fragen zu Themen, Problemen, die sich jenseits davon befinden, werden weder gestellt noch zugelassen. Resultat ist eine sich selbst genügende Ansammlung von unüberschaubaren, nicht mehr nachvollziehbaren Einzeldaten, Erkenntnissen ohne (Sinn-)Zusammenhang, ohne Bezug zur ganzen Wirklichkeit von Mensch, Natur, Welt.
Damit hat sich das am Exaktheitsideal der Naturwissenschaft orientierte Denken weit von unserem zivilisatorischen Selbstverständnis einer lebendigen Natur entfernt; hat sie zu einem neutralen Prozess bloß ablaufender Aktivitäten gemacht, den man beliebig manipulieren, gebrauchen, verwerten, entwerten kann.
Angesichts einer rücksichtslos ausgebeuteten, zerstörten, heillos verwundeten Natur weltweit, darf gefragt werden, ob die strikte Trennung einer Wertewelt hier und einem wertefreien Wissenschaftsbereich dort bei der Bewältigung der gegenwärtigen und zukünftigen Probleme wirklich ‚vernünftig‘, Vernunft gemäß ist.
5.
Kants enger Vernunft- und Wissenschaftsbegriff, basierend auf dem statischen Newton‘schen Paradigma eines lückenlos ablaufenden Kausalmechanismus und der Vorstellung von eindeutig lokalisierbaren, quantifizierbaren Gegenständen in Raum und Zeit wird weder einer lebendigen Natur-Welt-Wirklichkeit noch dem Menschen in seiner Existenzialität gerecht, geht an deren Bedeutsamkeit vorbei.
6.
Albert Einstein und Leopold Infeld betonen in ihrem Buch ‚Die Evolution der Physik‘: angesichts der Erkenntnisse der modernen Physik, in der es nicht mehr um das Verhalten von Körpern gehe, sondern um das zwischen ihnen Liegende, bedürfe es großer gedanklicher Kühnheit anzuerkennen, dass „das Verhalten des Feldes (im Dazwischen, M.R.) für die Ordnung und das Verständnis der Vorgänge maßgebend sein könnte“.
Seien wir kühn!
7.
Die ‚moderne‘ Physik des XX. Jahrhunderts, die zu einer grundlegenden Revision unserer Vorstellungen vom Universum, von Natur und unserem Verhältnis zu ihr geführt hat, ermutigt uns. Es geht nicht mehr vordergründig um einen logisch- kausalen Ablauf von Aktivitäten; nicht um eindeutig lokalisierbare, quantifizierbare Objekte, Körper, Substanzen und deren Verhalten, sondern primär um Ereignishaftigkeit, um das, was sich im Dazwischen ereignet: Energie, Interaktionsprozesse, (Inter)Relationalität, Wechselwirkung, Abhängigkeit, Veränderung etc. sind die eigentlichen ‚Tatsachen‘ der Welt; sie bilden die Voraussetzung für ein komplexes Natur- und Wirklichkeitsverständnis; Wirklichkeit als ein in jedem Augenblick sich vollziehender Prozess, der Veränderung bewirkt, Neues bereithält und zur Zukunft hin offen ist. Natur darf (wieder und neu) begriffen werden als ein umfassender Wirkzusammenhang; als ein grenzenloses, wechselseitig sich bewirkendes Energie-Beziehungsgeflecht in notwendiger Relation und Kommunikation zu- und miteinander…
8.
Auch der Vernunftbegriff muss neu definiert, erweitert werden. Das Wissenschafts-Paradigma des XX. Jahrhunderts ermutigt uns zu einer erweiterten, dynamischen, adäquateren Sichtweise auf Natur und Wirklichkeit. Dazu benötigen wir eine neue (Induktive) Metaphysik, einen neuen rationalen Rahmen für kreative, umfassende, zielführende Inter- und Transdisziplinäre wissenschaftliche Forschung; wir brauchen ein ‚vernünftiges‘ Meta-Denkgerüst, das die ganze Wirklichkeit im Blick behält und uns nicht die Hälfte davon unterschlägt. Die Prozessmetaphysik von A. N. Whitehead ist eine Option.
Der Vernunft darf durchaus etwas zugemutet werden, mehr als zuweilen geglaubt wird.
Gruß aus Berlin,
Maria Reinecke
Liebe Maria Reinecke,
vielen Dank für Ihren sehr ausführlichen und bemerkenswerten Kommentar, den ich selbstverständlich auch entsprechend würdigen möchte und schon mal als erster ein paar Gedanken hierzu äußern möchte.
Direkt eins vorab. Ich halte Ihre Thesen absolut nicht für „provokant“, sondern könnte sie von 1. bis 8. so unterschreiben; das habe ich auch selten ;-).
Zu 1.: Ich kannte das von Ihnen erwähnte Buch „Hartmut und Gernot Böhme in ‚Das Andere der Vernunft‘, 1985“ leider noch nicht, aber ich habe mir zumindest schon einmal das Inhaltsverzeichnis angeschaut, was schon sehr vielversprechend klang, z. B.:
„Kants Theorie entfremdeter Erkenntnis
1. Ein besonderer Erkenntnistyp.
Was ist Erkenntnis? / Die Erkenntnis des Fremden / Trennung und Herrschaft / Naturbeherrschung durch Selbstbeherrschung / Erkenntnis und Erkenntnistheorie / Erkenntnis als Gericht
2. Die Elemente der Kantischen Erkenntnistheorie
Das Ding an sich / Das gegebene Mannigfaltige / Das transzendentale Subjekt
3. Die Behauptungen
Der Verstand schreibt der Natur die Gesetze vor / Philosophie als Wahnwitz / Der Verstand bestimmt die Sinnlichkeit / Idealismus / Idealismus:
Freiheit durch Verdrängung des Leibes
4. Wissenschaft und Innerlichkeit“.
Vielen Dank für den Tipp.
Ich sehe das leider auch so kritisch mit der „Kritik der reinen Vernunft“. Da hat uns der „olle Miesepeter“ ein „Erbe hinterlassen“, das noch bis heute paradigmatisch nachwirkt. Der Kantsche Logozentrismus und das streng rationale Konzept der Aufklärung zeigt bis heute noch seine Nachwirkungen, die ich auch in einem anderen Essay „Die Dialektik der Aufklärungen – es werde endlich Licht!“ einmal zu beschreiben versucht habe. Es ist eben dort, wo viel Licht scheint, auch immer ein sehr großer Schatten.
Zu 2.: Genau daran musste ich eben auch denken, dass der „Wiener Kreis“ mit all seinem logischen Positivismus und sprachphilosophischen Wahrheitstheorien, wie z. B. die „semantische Wahrheitstheorie“ nach Tarski, eigentlich nichts anderes war als die konsequente Weiterführung der Kantschen Konzeption. Zu mehr Wahrheit hat dies aber theoretisch auch nicht geführt, sondern eigentlich nur zu einer „Ramseyfizierung des Denkens“.
Zu 3.: „Was dem Wissenschaftler als lebendige Gesamtheit der Natur-Mannigfaltigkeit unmittelbar als Vorwissen und Vorerfahrung (Alltagserfahrung) bekannt ist, wird bewusst vernachlässigt, abgespalten, seziert, auf Formeln reduziert und erst nach Kontrolle und Selektion im Labor als wissenschaftliches Datum anerkannt. Das am Exaktheitsideal der Naturwissenschaft orientierte Denken, das Aufgehen in Abstraktionen und die Verabsolutierung des Kausalitätsbegriffs sollen Objektivität garantieren.“
Das haben Sie hier sehr genau auf den Punkt gebracht, ich hätte es auch nicht anders formulieren können. Oder würde es ähnlich formulieren. Es ist aus meiner Sicht wiederum ein Beispiel für den naturwissenschaftlichen Diskurs und der dahinter liegenden Methodik, der Reduktion und Induktion. „Chaos“ – im Sinne von ungeordneter, unsystematischer Fülle ist der Naturwissenschaft ein Graus. Die Datenmenge muss hinsichtlich willkürlich festgelegter Parameter reduziert und filtriert werden. Aus dem Filtrat lässt sich dann durch Induktion eine Gesetzmäßigkeit herleiten. Die Gesetzmäßigkeit muss durch Falsifikation im Experiment überprüft werden, u.s.w. Ja, ja, so geht die große Tretmühle des Empirismus. Alles ist ja so objektiv, die Messdaten stammen ja aus dem gewählten Instrument/Apparat. Alles ist ja so rational, da es logischen Gesetzen unterliegt und vielleicht noch quantifizierbar ist. Und alles ist so effizient, das heißt, es ist (zumeist) technologisch reproduzierbar und (vielleicht) anwendbar. So weit der Glaube der Naturwissenschaft. Thomas S. Kuhn hat in seinem Buch „The Structure of Scientific Revolutions“ sehr deutlich anhand von wissenschaftlichen Paradigmenwechsel den subjektiven Charakter dieser Wissensbeschaffung und Kenntnisgewinnung aufgezeigt. Es geht bei solcherlei Theoremen auch immer um den Machterhalt oder um Machtverhältnisse innerhalb der wissenschaftlichen Disziplin.
Aber das ist ja genau die spannende Frage: „Was ist eigentlich die genaue Funktion der Wissenschaft?“ Die Wissenschaft findet ja nicht im luftleeren Raum statt oder wird von Maschinen betrieben (die müssten allerdings auch programmiert sein). Die Wissenschaft wird von Menschen betrieben und findet in einer menschlichen Gesellschaft statt, mal mit mehr oder weniger Auswirkungen. So muss sich die Wissenschaften und hier insbesondere die Naturwissenschaften doch früher oder später einmal mit ihrem eigenen Standpunkt auseinandersetzen. Der Hinweis, dass Naturwissenschaften auf einer materialistischen und rationalistisches Basis für ihr „Wissensgebäude“ stehen, ist wohl unschwer von der Hand zu weisen und wird auch gerne von Naturwissenschaftlern als Schutzschild vor sich hergetragen. Die philosophischen Aspekte der wissenschaftlichen Arbeit werden nur allzu gerne ausgeklammert. Wohin dies in Bezug zum Beispiel hinsichtlich der Ethik führen kann, muss ich hier wohl nicht weiter erläutern.
Zu 5.: Stimmt, s. o.
Zu 6.: Vielen Dank für den Buchtipp. Ich werde mal Christian als ausgewiesenen Einstein-Kenner hierauf ansprechen. Ich habe auch noch ein schönes Zitat vom „Großmeister“ selber gefunden, dass ich zu diesem Thema sehr vielsagend empfand:
„Eine katastrophale Angst vor der Metaphysik [ist die] Krankheit der heutigen empiristischen Philosophie. […] Diese Angst scheint das Motiv dafür zu sein, beispielsweise ›ein Ding‹ als ›ein Bündel von Eigenschaften‹ zu interpretieren, – ›Eigenschaften‹, die wir, wie man glaubt, im Rohmaterial unserer Sinne entdecken können. […] Ich hingegen sehe keine ›metaphysische Gefahr‹ darin, die Vorstellung von einem physikalischen Ding (oder einem physikalischen Objekt) zusammen mit den zugehörigen Raum-Zeit-Strukturen als autonomen Begriff innerhalb des Systems zuzulassen.“ (Aus: A. Einstein, Remarks on Bertrand Russell’s Theory of Knowledge, in: P. A. Schilpp (Hrsg.), The Philosophy of Bertrand Russell, The Library of Living Philosophers, Bd. V, 1944, s. 290f. Zitiert nach: Popper 2002, 92.)
Ich glaube, Einstein hatte auch in diesem Punkte mal wieder Recht.
Zu 7.: Ich hoffe, Sie behalten auch in diesem Punkte Recht. Die moderne Physik besitzt nämlich momentan leider keine metaphysische Basis im ontologischen Sinne für zum Beispiel so vermeintlich selbstverständliche Begriffe, wie z. B. „Raum“ oder „Zeit“.
Andererseits betreibt die „moderne Physik“ in Ihrer Methodik aber geradezu „Metaphysik“ im „epistemologischen Sinne“, in dem Sie ihrer alten induktiv-empirischen Methodik einfach mal über „Bord geworfen hat“ und stattdessen lieber „abduktive Forschung“ betreibt.
Ich denke, dass die Problematiken der „Kopenhagener Deutung“, die mit Bohrs und Heisenbergs „Interpretationen zur Quantenmechanik“ ein Tor zur Hermeneutik und damit auch zur Metaphysik aufgestoßen haben, dass sie so schnell nicht wieder zu bekommt und das die „moderne Physik“ in eine Sackgasse geführt hat, aus der sie ohne fremde Hilfe (z. B. Philosophie in Form einer Wissenschaftstheorie) auch gar nicht mehr herauskommen. Mit diesem Thema hat sich besagter Christian schon ausführlicher beschäftigt, dessen Link ich hier vielleicht anführen darf: https://cbuphilblog.wordpress.com/2021/01/17/kommentar-zu-metaphysischen-fragen-in-der-physik/
Noch ein Hinweis zu diesem Thema, das Physiker nicht so gerne hören mögen. Sabine Hossenfelder vom Frankfurt Institute for Advanced Studies hat mit ihrem Buch „Das hässliche Universum“ sogar auf die ästhetischen Aspekte des „Schönheitswahn der Theoretischen Physik“ hingewiesen, die seit Jahrzehnten einen Durchbruch in der Grundlagenphysik verhindern und „mittlerweile in Konflikt mit wissenschaftlicher Objektivität“ geraten. Na, wenn das so schon soweit ist, dass „Schönheit“ ein Kriterium für wissenschaftliche Forschung ist, dann „Prost, Mahlzeit“. Dann kommen irgendwann solche metaphysischen Konstrukte, wie die „String-Theorie“ mit ihren 11 Dimensionen heraus?!?
Daher wäre aus meiner Sicht ein philosophischer Input für die modernen Naturwissenschaften als Neue Metaphysik mehr als überfällig. Vielleicht bietet tatsächlich Whiteheads Prozessphilosophie hier noch einiges an Ressourcen an.
Zu 8.: s. 7., aber wenn ich auch noch auf meiner Wunschliste für eine Neue Metaphysik ergänzen dürfte, würde ich auch noch neben Whiteheads Prozessphilosophie die Polykontexturalität von Gotthard Günther in Form einer mehrwertigen Logik mit ins Boot holen, da sie aus meiner Sicht hervorragend dazu geeignet ist, die von Ihnen vorgeschlagene „erweiterte, dynamische, adäquatere Sichtweise auf Natur und Wirklichkeit“ mathematisch abzubilden. Ohne eine entsprechende mathematische Grundlage befürchte ich wird. Wenn ich hier noch einmal zum Schluss den Initiator Kant zitieren darf:„die Metaphysik mit der Geometrie zusammenbringen, da man Greife leichter mit Pferden als die Transzendentalphilosophie mit der Geometrie verbinden [kann]“. So kommt es mir manchmal auch vor mit der ganzen Interdisziplinarität, ohne die es meines Erachtens aber nicht geht. Ansonsten sitzen die einen weiterhin vor ihren „Mikroskopen“ und finden Phenomena in der Welt, die sie eigentlich schon vorher gesehen haben, nur nicht erkannten. Und die anderen sitzen weiterhin vor ihren „Logoskopen“ und suchen verzweifelt nach den Noumena, die sich nicht erkennen, weil sie nicht sehen können ;-).
Nochmals vielen Dank für Ihren Kommentar und
viele Grüße aus dem Münsterland
Danke, Dirk Boucsein, das habe ich auch selten…:)
(Wollte natürlich den Sternbutton drücken, funktionierte leider nicht).
Danke für den Hinweis auf Gotthard Günther (ja, ohne Mathematik geht gar nichts)
und den Link von Christian. Internet at its best.
Ist es nicht befremdend, dass der ‚gebildete Bürger‘ im deutschsprachigen Raum den umwälzenden Erkenntnissen der Physik des XX. Jahrhunderts und dem daraus resultierenden philosophischen Diskurs nur „mit einem gediegenen Desinteresse begegnet“? (Herausgeber Jürgen Busche, Nachwort zu Werner Heisenberg, ‚Quantentheorie und Philosophie‘, 1986) – ganz zu schweigen von den ‚Berufs-Philosophen‘, denen es egal zu sein scheint, ‚ob der Mond aus Käse besteht oder sonst etwas’… (frei nach Wolfgang Stegmüller, Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie Bd. 1, 1978).
Es sind offenbar nicht die sensationellen wissenschaftlichen Forschungsergebnisse, die ein Umdenken bewirken, sondern erst eine gründliche philosophische Besinnung danach; Einordnung der neuen Erkenntnisse in einen neuen, erweiterten, zu erweiternden Meta-Zusammenhang. Eine derartige umfassende philosophische/metaphysische Auseinandersetzung mit dem neuen Wissenschafts-Paradigma des XX. Jahrhunderts hat es im deutschsprachigen Raum m.E. nur unzureichend gegeben.
Da war Niels Bohr:
Vollblutphysiker und halbherziger Philosoph; wie den meisten seiner Kollegen widerstrebte ihm jedwede ontologische/metaphysische Betrachtungsweise. Er beschränkte sich auf die aktive Rolle, die der Mensch bei der Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnis spielt; ein rein anthropozentrisches Konzept: wir entscheiden, was wirklich ist. Was wir nicht experimentell fokussieren, wird ignoriert.
Da war Werner Heisenberg:
Vollblutphysiker und halb Philosoph – als Philosoph jedoch mutiger als Bohr.
Heisenberg stellte sich zumindest den ontologischen Fragen und regte in der ‚Kopenhagener Deutung der Quantentheorie’ den philosophischen Diskurs an. Der Text ist Fundgrube für Esoteriker und esoterisch Angehauchte geworden, die meinen, mit der Quantentheorie und Quantenmechanik nun alles Mögliche erklären zu können, nicht zuletzt, dass wir mit unserem Geist/Bewusstsein bestimmen können, was geschieht oder nicht, wenn wir uns nur richtig darauf konzentrieren – das sei durch die merkwürdigen Ergebnisse bei der Messung von Teilchen experimentell nachgewiesen. Obwohl Heisenberg diesen Gedanken mit einem Satz vom Tisch wischt, indem er sagt: „…Sicher enthält die Quantentheorie keine eigentlich subjektiven Züge, sie führt nicht (etwa) den Geist oder das Bewusstsein des Physikers als einen Teil des Atomvorganges ein.“ (S. 57) Beobachtung nicht als psychischer Akt, sondern als ein physikalischer; Wechselwirkung des Gegenstandes mit der Messanordnung etc…
Da waren natürlich einige mehr.
Aber ich denke manchmal, vielleicht fehlte damals einfach ein Vollblutwissenschaftler, der zugleich Vollblutphilosoph war; einer, der kühn und gewillt war, das Ganze von Grund auf neu und anders zu denken, einer wie A.N. Whitehead: Mathematiker, Physiker und Philosoph.
Vielleicht wäre der philosophische Diskurs im deutschsprachigen Raum fruchtbarer verlaufen, wenn Whitehead im entscheidenden Augenblick nicht nach Amerika gegangen wäre, sondern in Europa geblieben wäre…? Keine Ahnung.
Heute erstmal Punkt. Nicht Schluss.
Viele Grüße.
Danke,
Maria Reinecke
Guten Abend, Frau Maria Reinecke,
es freut mich, dass Ihnen meine Seite gefallen hatte. Danke Dirk für die Vorschusslorbeeren des „Einstein-Kenners“. Tatsächlich komme ich nur selten in das Vergnügen, mich weiter zu belesen, wie man auch an diesem späten Kommentar sehen könnte, weil ich zuvor noch ein wenig mehr weiter oben von der Unterhaltung lesen mochte, aber nie so recht die notwendige Zeit mit der notwendigen Konzentration fand.
Auch das Schreiben ist zwar ein Mittel, sich um Präzision bemühen zu können, für eine rege und umfangreiche Mitteilung von Gedanke fehlt aber oft die Zeit für diese Mühe … und kommt dann ggf. nie zustande.
Mich interessiert Ihr umfangreiches Wissen über Whitehead und Mach über die schmalen Sätze hinaus in einem Dialog. Dirk deute auch schon an, dass wir einmal zusammen ins Gespräch kommen könnten. Es würde mich sehr freuen, wenn wir dies über Zoom oder Telefon mal machen könnten. Ich schicke eine E-Mail.
Für heute auch erst einmal als Kommentar leider nur diese Worte, keine fachliche Diskussion zu der ein oder anderen These. Obwohl mich Bohr und Heisenberg sehr reizen, wie Sie wissen könnten. Ich hoffe, das enttäuscht Sie nun nicht.
Sie zitierten einmal aus einem Buch, wobei angedeutet war, dass Sie die Autorin sind. Ein Blick auf Amazon zeigte mir diese und eine kleine Biographie von Ihnen. Das Buch werde ich gern einmal lesen, habe ich mir fest vorgenommen.
Viele Grüße
Christian
September 2022
Holà, Philosophies:
Mir ist bewusst: die Begeisterung für die Prozessmetaphysik eines A.N. Whitehead angesichts einer merkwürdigen Whitehead-Ignoranz im deutschsprachigen Raum birgt die Gefahr, als Sektierertum abgetan zu werden – I Gott bewahre!, (bin nicht einmal in der ehrwürdigen Whitehead-Gesellschaft!).
Bleibt eine schwierige Situation:
Auf der einen Seite lesen wir berühmte unmissverständliche Forderungen an die Metaphysik, z.B. von
Werner Heisenberg, in seinem Vortrag 1941 in Leipzig, ‚Die Einheit des naturwissenschaftlichen Weltbildes‘:
„Wir sind uns mehr als die frühere Naturwissenschaft dessen bewusst, dass es keinen sicheren Ausgangspunkt gibt, von dem aus Wege in alle Gebiete des Erkennbaren führen, sondern dass alle Erkenntnis gewissermaßen über einer grundlosen Tiefe schweben muss; dass wir stets irgendwo in der Mitte anfangen müssen, über die Wirklichkeit zu sprechen mit Begriffen, die erst durch ihre Anwendung allmählich einen schärferen Sinn erhalten, und dass selbst die schärfsten, allen Anforderungen an logischer und mathematischer Präzision genügenden Begriffssysteme nur tastende Versuche sind, uns in begrenzten Bereichen der Wirklichkeit zurechtzufinden….Aber die Ahnung eines großen Zusammenhangs, in den wir mit unseren Gedanken doch schließlich immer weiter eindringen können, bleibt auch für uns die treibende Kraft der Forschung…“ (W. Heisenberg, a.a.O.)
„…Ein Weltbild muss, wenigstens grundsätzlich, alle Bereiche der Welt umfassen können, in ihm muss jedem Bezirk der Wirklichkeit ein bestimmter Platz zugewiesen sein.“ (W. Heisenberg, a.a.O.)
Und von C.F. von Weizsäcker, ,Die Einheit der Natur‘, München 1979; S. 425)
„Ich erwarte, dass ein Aufbau der ganzen Physik aus einem Prinzip in der Tat gelingen wird, und meine eigenen, noch unfertigen Arbeiten dienen diesem Ziel.“ (C.F. von Weizsäcker, a.a.O.)
etc.
Auf der anderen Seite steht A.N. Whitehead, der als Naturwissenschaftler und Philosoph sich genau diese strenge Forderung an die Metaphysik zur Aufgabe gemacht hat und sie in seiner organistischen Prozessmetaphysik, basierend auf den Erkenntnissen der modernen Physik, umfassend umgesetzt hat!
Nun ist es aber zum Glück auch so, dass – obwohl der Name Whitehead als Quelle oft gar nicht erwähnt wird – Whiteheads prozessphilosophisches Denken in Deutschland längst fruchtbarer (z.T. unbewusst) metaphysischer Hintergrund für viele geistige Strömungen geworden ist (ich folge hier der Aufzählung von Hans Jürgen Holl in seinem Nachwort zu Whiteheads Hauptwerk ‚Prozess und Realität‘, 1987): Strukturalismus, Kommunikationstheorie, Methodenanarchismus, kritischer Rationalismus, wissenschaftstheoretische Paradigmenforschung, Systemtheorie…; würde aber gern hinzufügen, dass Whiteheads dynamischer, organistischer/organismischer metaphysischer Ansatz insgesamt eine wichtige Quelle für die zeitgemäße Forschung darstellt; nicht zuletzt ermöglichen prozessphilosophische Betrachtungen eine adäquatere Behandlung zentraler Probleme des Lebens, alles Lebendigen; Fragen, die im rein biowissenschaftlichen Diskurs nicht hinrei-chend diskutiert werden können. Prozess-metaphysische Denkansätze finden sich in der Neurobiologie und Biophysik, in der Bewusstseinsforschung und Neurogenetik ebenso wie in der Welt des Konzern-Managements, in Soziologie und Theo-logie… (nicht zu vergessen: H. Leschs Lieblingsphilosoph ist nicht umsonst A.N. Whitehead, Ja!
Ich bin übrigens ziemlich aufgeregt, lese z.Zt. Christian Bührings E-Book/Büchlein: https://cbuphilblog.wordpress.com/buchprojekt/ „Gott würfelt nicht“ oder „Es werde Nichts“, wozu ich alle Philosophies ermuntern möchte!
Soweit ich das bereits sagen kann, schwingt auch hier Whitehead mit, „Kontinuum – Ontologie“, ja; einheitliche Feldtheorie, ja; Whitehead war einer der ersten, der das metaphysisch ins Spiel brachte…, genug, genug, gemach, gemach, M.R., nicht zu viel Begeisterung, sonst…!
Gruß aus Berlin,
M.R.
Danke für deine Begeisterung! Die Leseempfehlung mag ich gern bestätigen 😉
Christian
Du hast mich neugierig gemacht, von A. N. Whitehead mehr zu erfahren. Hier gibt es eine Videosammlung, die ich hier für alle verlinken mag:
https://www.youtube.com/channel/UCYbTr5tuqdB8l8xicEShdMg/videos
@philo sophies
Ein Gedankensplitter, der vielleicht hier reinpasst – (s. auch Rudolf Carnap und die Metaphysikfeindlichkeit des Wiener Kreises)
„Gesprächssplitter 16“ zu metaphysischen Fragen aus der Reihe „Gedankensplitter“, Maria Reinecke, Berlin:
(frei nach Wolfgang Stegmüller, Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie III)
A: Lass uns noch einmal kurz zurückkommen auf unsere Folge 9, glaube ich; da hast du von der Sinnlosigkeit metaphysischer Begriffe gesprochen, nein, du natürlich nicht, sondern die Logischen Empiristen. Das klingt für mich ziemlich unversöhnlich, was Rudolf Carnap formuliert, geradezu aggressiv. Wie wird das heute eigentlich gesehen?
B: Carnap selber ist sich natürlich der ganzen philosophischen Problematik bewusst. Er hat seine eigene Auffassung oft geändert und viele seiner Untersuchungen und Theorien nur als „erste Entwürfe“ oder „erste Versuche“ bezeichnet, jedenfalls nie den Anspruch auf Endgültigkeit erhoben. Interessanterweise benutzt er für die Tätigkeit des Philosophen ein Analogiebild; er vergleicht den Philosophen mit dem Ingenieur; dieser arbeitet beispielsweise an der Konstruktion und Entwicklung eines neuen Flugzeugtyps. Nach Carnap ist auch der Philosoph ein Konstrukteur, nicht von materiellen technischen Dingen, sondern von Wissenschaftssprachen. Der Ingenieur wird nicht sagen, dass seine letzte Kreation die endgültig beste und nicht mehr ausbaufähig sei, sondern an der Weiterentwicklung des Modells interessiert sein und Anregungen von anderen aufnehmen, übernehmen. Ähnlich sollte auch der Philosoph an der rationalen Rekonstruktion der Wissenschaftssprache arbeiten, immer im Wechselspiel von Entwurf, Kritik, Gegenkritik und Verbesserungsvorschlägen.
Was also Logik und Wissenschaftstheorie betrifft, hat Carnap hier unbezweifelbar recht.
A: Wie sieht es aber mit dem Sinnkriterium für metaphysische Fragen aus? Hat der Logische Empirismus wirklich nachweisen können, dass Metaphysik insgesamt sinnlos sei?
B: Nein. Der Nachweis, dass Metaphysik sinnlos sei, ist durch den Logischen Empirismus nicht erbracht worden. Denn letztlich ist das empiristische Sinnkriterium eine Sache des Beschlusses, logisch jedoch nicht weiter zu begründen. Es handelt sich dabei um Beschlüsse innerhalb der Syntax der jeweiligen Wissenschaftssprache; und solche Beschlüsse müssen nicht akzeptiert werden. Popper spricht deshalb statt von Sinnkriterien von Abgrenzungskriterien; er will die logischen, mathematischen und erfahrungswissenschaftlichen Aussagen lediglich von der Metaphysik abgrenzen.
A: Und was sagt der Metaphysiker dazu? Lässt er sich das vernichtende Urteil der Empiristen gefallen?
B: Dem Metaphysiker stehen zwei Wege offen, sich erfolgreich zu verteidigen: 1. Er braucht die empiristische Fassung des Wissenschaftsbegriffs nicht zu akzeptieren. Er könnte z.B. argumentieren, dass der Begriff „Wissenschaft“ durchaus vage ist – was übrigens auch von Carnap so gesehen wird – und immer eine konventionelle Komponente in sich trägt, so dass bei einer erweiterten Fassung dieses Ausdrucks auch metaphysische Aussagen in die wissenschaftlichen Sätze eingeordnet/untergeordnet werden können. 2. Der Metaphysiker könnte aber auch zugestehen, dass seine Tätigkeit nicht die eines Wissenschaftlers im o.g. Sinne sei; dass seine Forschung trotzdem sinnvoll sei, wenn auch nicht im empiristischen Sinne. Allerdings, wenn der Metaphysiker den Anspruch erhebt, Wissenschaft zu betreiben und er wissenschaftslogische Prinzipien der Begriffsbildung und Begründung anerkennt, dann darf er nicht bei der konkreten Durchführung seines Systems gegen diese Prinzipen verstoßen. Der Metaphysiker muss seine neu eingeführten Begriffe genau erklären und seine Behauptungen begründen können und – wie jeder andere Wissenschaftler auch – sich grundsätzlich der Situation aussetzen, dass Unklarheiten und Fehler in seinen Begriffen und Begründungen kritisch geprüft und nachgewiesen werden.
A. Das erinnert an die Induktive Metaphysik, die du mal erwähntest, von dem – wie hieß der nochmal: Whitehead,
ja A. N. Whitehead…
B: Genau. Whiteheads Prozess-Metaphysik ist eine Metaphysik, die alle wissenschaftlichen Prinzipen der Begriffsbildung und logischen Begründung anerkennt und bei der konkreten Durchführung des Systems nicht gegen diese Prinzipien verstößt. Sie basiert darüber hinaus auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen aus allen Bereichen und ermöglicht so eine neue, erweiterte Sicht der gesamten Lebenswirklichkeit…
A. Wir sind unterbrochen worden. Was wolltest du sagen?
B: Natürlich kann der empiristische Wissenschaftler dem Metaphysiker von vornherein jede Fähigkeit zu begrifflicher Klarheit und Exaktheit in der Beweisführung absprechen; denn wissenschaftliche Aussagen, egal wie weit Wissenschaft gefasst werden mag, würde er sagen, müssen auf jeden Fall in einer intersubjektiv verständlichen Sprache formuliert sein, und da die Grundbegriffe der Metaphysik keinen empirischen Bezug haben, sei eine Verständigung über den Sinn metaphysischer Aussagen eben nicht möglich. Aber auch dieses Argument ist nicht aufrecht zu erhalten.
Erinnert sei dabei an Kants Metaphysik, die formal gekennzeichnet ist durch synthetische Sätze a priori, d.h. durch Erkenntnisse aus reiner Vernunft. Diese Kennzeichnung steht nicht im Widerspruch zum empiristischen Sinnkriterium, denn: für synthetische Aussagen a priori gilt nur, dass ihre Begründung ohne Zuhilfenahme von Beobachtungssätzen möglich ist, was durchaus mit ihrer empirischen Bestätigungsfähigkeit in Einklang stehen kann.
Wenn dann aber der Logische Empirist entgegnete, dass es gar keine synthetischen Aussagen a priori gäbe, wäre seine negative Existenzbehauptung ihrer logischen Struktur nach gerade das, was sie in Abrede stellt: eine synthetische Behauptung a priori.
A: Wahnsinn. Dann ist also die ganze Polemik in der Metaphysik-Debatte grundlos?
B: Kann man so sagen. Der Empirist sollte jedenfalls keine Thesen über das durch ihn Begründbare hinaus vertreten, weil er sie letztlich nur mit metaphysischen Argumenten vortragen kann. Und der Metaphysiker sollte keine Angst vor empiristischem Wissenschaftsdenken haben und darin kein „positivistisches Teufelszeug“ sehen, das nur dazu dienen soll, sein System zu zerstören.
Maria Reinecke, Berlin
Danke, Christian, für das geweckte Interesse an Whitehead, für Deine eigene Begeisterung und das Du.
Zu Deiner schnellen Whitehead Video-Auswahl schnell eine Reaktion: die Videos erscheinen mir eher kontraproduktiv.
Whitehead vertritt z.B. keinen Pantheismus/Panentheismus, so gern das auch immer wieder weitergetragen wird, weil irgendwie en vogue; insgesamt: prozessphilosophisches Denken esoterisch verzerrt, z.T. trivialisiert und für alles Mögliche vereinnahmt…, schmerzlich.
Lesen lohnt.
Wenn schon Theismus/GOTT, dann doch so, wie Du es anklingen lässt:
https://cbuphilblog.wordpress.com/2019/02/23/jochen-kirchhoff-masse-materie/
„Es wäre sicherlich ein spannendes Forschungsthema, bei den Helden der Physik ihre metaphysischen geheimen Wünsche einmal darzulegen“.
Hier nur kurz für Interessierte:
GOTT ist bei Whitehead kein heimlicher Wunsch, sondern explizit:
– das Prinzip der Kreativität
– die unendliche Grundlage aller Geistestätigkeit, die Einheit der Vision, die nach physischer Vielheit strebt.
– Beide, GOTT und die Welt, sind dem Zugriff der elementaren metaphysischen Grundlage ausgesetzt: dem kreativen Fortschreiten ins Neue…
„Gott und die Welt stehen einander gegenüber und bringen die letzte metaphysische Wahrheit zum Ausdruck, dass strebende Vision und physisches Erleben gleichermaßen Anspruch auf Priorität haben.“ (A.N. Whitehead, ‚Prozess und Realität‘ 1987, S. 622)
(‚Das Böse‘ dagegen als „zersplitterte Zwecksetzung“, Whitehead)
etc.
p.s. zu Christian Bührigs E-Book/Büchlein:
https://cbuphilblog.wordpress.com/buchprojekt/ „Gott würfelt nicht“ oder „Es werde Nichts“.
Habe erst kurz darin gelesen, nur soviel vielleicht:
Der Autor lässt den Leser gleich zu Anfang überraschend teilhaben an der Tiefe und Weite vorsokratischen Denkens;
Thales, Anaximander, Anaximenes kommen zunächst zu Wort; es erfüllt mit Freude, den eindringlichen, ruhig dahinfließenden Gesprächen zu lauschen und den metaphysischen Fragen nach dem Ursprung aller Dinge;
Fragen, die nichts von ihrer Brisanz und Bedeutung verloren haben, schon gar nicht auf dem Hintergrund der modernen Physik des XX. Jahrhunderts. Ich bin gespannt, wie der Autor die Gedankenwelten von 585 v. Chr. bis 368 v. Chr. und heute miteinander verbinden wird.
@ admin/Dirk
Lieber Dirk Boucsein,
obwohl Medienmuffel, der ich nun leider bin – was virtuelle Chat/Gesprächsräume (Zoom etc.) betrifft (verzeihen Sie!) – genieße ich umso mehr die pointierten, klugen, z.T. salopp-flapsigen, immer irgendwie anregenden schriftlichen Kommentare/Gedanken zu kompakten Themenbereichen hier bei Philosophies. Danke.
Vielleicht passt das Whiteheadsche Augenzwinkern zu dem, was Sie oben sagen:
„In der philosophischen Diskussion ist die leiseste Andeutung dogmatischer Sicherheit hinsichtlich der Endgültigkeit von Behauptungen ein Zeichen von Torheit.“ (A. N. Whitehead, ‚Prozess und Realität‘)
Später mehr,
herzlich aus Berlin,
Maria R.
Liebe Maria Reinecke,
vielen Dank für Ihr sehr freundliches Kompliment, was ich aber in vollem Umfang auch an Sie wieder zurück geben kann.
Bitte mehr von Ihren pointierten, profunden und professionellen Kommentaren; gerne auch mit einem „Whiteheadschen Augenzwinkern“ ;-).
Ich freue mich von Ihnen zu lesen und schicke ebenfalls
herzliche Grüße nach Berlin
Dirk Boucsein